„Wir holen Pflegebedürftige ein Stück zurück in die Gesellschaft”
Eine sektorenübergreifende gerontopsychiatrische Pflege kann den Betroffenen helfen und volkswirtschaftlich sinnvoll sein. Davon ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland/Hamburg, Matthias Mohrmann, überzeugt. Im Gespräch mit G+G verweist er auf die positiven Erfahrungen aus dem laufenden Innovationsfonds-Projekt „SGB Reha“.

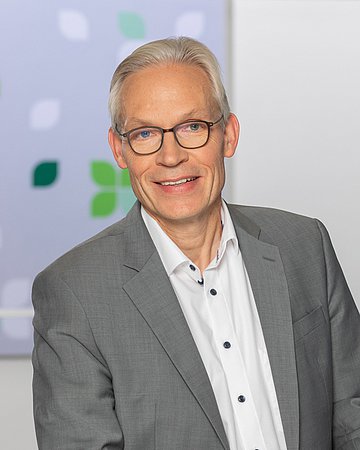
Seit 2022 läuft das Innovationsfonds-Projekt „Sektorenübergreifende gerontopsychiatrische Behandlung und Rehabilitation in Pflegeheimen“, kurz SGB Reha, unter Führung der AOK Rheinland/Hamburg. Was war der Anlass für dieses Projekt?
Matthias Mohrmann: Zu diesem Projekt gibt es eine Vorgeschichte: In Mülheim an der Ruhr hatten zwei Häuser der Evangelischen Altenhilfe mit einer therapeutisch orientierten Altenpflege begonnen, um die Fähigkeiten pflegebedürftiger Menschen möglichst lange zu erhalten. Zur Umsetzung dieses Pflegeansatzes konnten die Einrichtungen auf Mittel von Fördervereinen und anderen Quellen zugreifen. Wir sind mit der Heimleitung ins Gespräch gekommen und fanden die Idee gut und unterstützenswert. So ist es dann zu dem Antrag auf Förderung des Modells aus dem Innovationsfonds gekommen. Dazu haben wir Konsortial- und Kooperationspartner gefunden, die sich an dem Projekt beteiligen. Momentan nehmen elf Pflegeheime teil. Aus diesen Häusern sind jeweils etwa 15 Pflegebedürftige in das Projekt integriert, also nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung.
Was läuft in diesen Pflegeheimen anders?
Mohrmann: Auch in der stationären Pflege haben die Menschen häufig noch Fähigkeiten, die sie selbstständig ausüben können. Auf diese kann aber im eng getakteten Pflegealltag nur unzureichend Bezug genommen werden. Ziel der sogenannten therapeutischen Pflege bei SGB Reha ist es, solche Selbstständigkeiten etwa in der Mobilität oder auch in der Hygiene zu erhalten oder sogar wiederzuerlangen, sodass eine Pflegebedürftige oder ein Pflegebedürftiger zum Beispiel wieder Treppensteigen kann oder in der Lage ist, mit einem Rollator allein nach draußen zu gehen.
Was muss sich dazu an den Anforderungen an das Pflegefachpersonal ändern?
Mohrmann: Nicht an den Anforderungen, sondern am Alltag ändert sich etwas. Die Pflegekräfte sind ja grundsätzlich in der Lage und auch dazu ausgebildet, ressourcenorientiert und aktivierend zu arbeiten. Innerhalb des Projekts bekommen sie zusätzlich Anleitung von externen Therapeutinnen und Therapeuten, um konkrete therapeutische Impulse im Pflegealltag umsetzen zu können. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit erfolgt ein Wissenstransfer an die Pflegekräfte, aber auch im Team untereinander. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Mitarbeitenden die Möglichkeiten der therapeutischen Pflege sehr schätzen. Zu den Zielen von SGB Reha gehört auch, die Fluktuation in der Belegschaft innerhalb der Einrichtungen zu senken und die Zahl der Bewerbungen zu erhöhen. Denn die Pflegenden sehen die Erfolge ihrer Arbeit, wenn Pflegebedürftige einen Teil ihrer Selbstständigkeit wiedererlangen.
Welche Erfolge sind das?
Mohrmann: Das Projekt SGB Reha ist grundsätzlich für alle Pflegebedürftigen geeignet. Wichtig ist zunächst, bei einem alten Menschen einen persönlichen Antrieb zu wecken, ein Ziel, für das er sich einsetzen oder das er erreichen möchte. Ganz ohne eigene Motivation geht es nicht. Aber die meisten Menschen haben noch Ziele: Sie möchten vielleicht bei der Einschulung der Enkel dabei sein oder mal wieder in ein Restaurant gehen. Das sind mitunter sehr niedrigschwellige Ziele. Wenn sich bei einem Pflegebedürftigen eine solche Motivation wecken lässt, kommt das Modell in Frage. Die therapeutische Pflege ist für die Betroffenen ja durchaus mit Anstrengungen und Trainingsdisziplin verbunden, es ist ein bisschen wie beim Sport. In einzelnen Fällen kann es dann aber sogar gelingen, dass Pflegebedürftige aus der Einrichtung wieder zurück in ihr Zuhause ziehen können, aber das ist natürlich eine Ausnahme.
Warum ist eine solche therapeutische Pflege kein Standard?
Mohrmann: Es fehlt bisher der Anreiz, in den Erhalt von Fähigkeiten Pflegebedürftiger zu investieren. Wir haben in der Pflege eine klare Orientierung: Je höher die Pflegebedürftigkeit ist, desto höher ist der Pflegegrad und desto mehr Geld gibt es. Das ist im Prinzip auch richtig. Für eine intensive Pflege fällt ein höherer Pflegeaufwand an. Was wir vermissen, ist der Anreiz, dafür zu sorgen, die Mobilität und Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen möglichst lange zu erhalten oder sogar wiederherzustellen. Es ist in unserem Gesundheits- und Pflegesystem nicht vorgesehen, dass eine Pflegeeinrichtung hier in relevantem Maße investiert. Deshalb unterstützt der Innovationsfonds während der Projektlaufzeit die beteiligten Heime mit finanziellen Mitteln.
Welche Anreize müssten gesetzt werden?
Mohrmann: Es geht um das Zusammenwirken von gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) und sozialer Pflegeversicherung, also um das Fünfte und das Elfte Sozialgesetzbuch. Deshalb sprechen wir von einem sektorenübergreifenden Projekt. Das Wiederherstellen von Selbstständigkeit ist durchaus eine Aufgabe der GKV. Der „Ertrag“ aber kommt der Pflegeversicherung – auch den Kommunen, die oft den Eigenanteil des Versicherten übernehmen – zugute, wenn ein Betroffener oder eine Betroffene dadurch einen geringeren Pflegegrad hat und weniger Leistungen benötigt. Zugleich hätte das Pflegeheim geringere Einnahmen. Hier müssen auf politischer Ebene die Weichen anders gestellt werden. Denn dass sektorenübergreifende gerontopsychiatrische Behandlung und Rehabilitation möglich sind, den Betroffenen helfen und auch volkswirtschaftlich sinnvoll sein können, zeigen wir gerade mit dem Innovationsfondsprojekt.
Sehen Sie denn auf der politischen Ebene die Bereitschaft zu gesetzlichen Anpassungen?
Mohrmann: Wir haben in Deutschland schon jetzt eine große Zahl von älteren Menschen, und die geburtenstärksten Jahrgänge kommen erst noch in die Phase der Pflegebedürftigkeit. Daher stehen wir gesamtgesellschaftlich vor der Frage: Wie wollen wir die Pflege künftig gestalten? Verwahren und verköstigen wir die alten Menschen lediglich? Oder versuchen wir, so lange wie möglich ihre Selbstständigkeit zu erhalten? Dabei spielt auch der Aspekt der Würde eine wichtige Rolle. Denn wir ermöglichen mit der therapeutischen Pflege den Menschen wieder mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wir holen sie ein Stück zurück in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit.
Das Innovationfondsprojekt endet zur Jahresmitte 2026. Sehen Sie Chancen, dass therapeutische Pflege danach als Standard in die Versorgung einfließen wird?
Mohrmann: Zu einhundert Prozent, sonst würden wir das nicht machen. Wir haben Respekt vor der Größe der Aufgabe und wir benötigen Unterstützer an jeder Stelle. Aber ich glaube, wer sich das Projekt SGB Reha einmal vor Ort selbst anschaut und nicht nur mit den Bewohnerinnen und Bewohnern oder den Angehörigen spricht, sondern auch mit den Pflegekräften, der lässt sich leicht von der Idee überzeugen, wird sich aber auch bei anderen für die Umsetzung dieses Ansatzes engagieren.
Mitwirkende des Beitrags

Autor




Datenschutzhinweis
Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.