„Zukunftsfeste Gesundheitsversorgung schmerzt auch mal“
Die Universitätsmedizin Essen hat sich mittels Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren zu einem Smart Hospital entwickelt. Was das für die Klinik und Patienten konkret bedeutet, wo die deutsche Krankenhauslandschaft im Jahr 2050 stehen könnte und was er von der neuen Bundesgesundheitsministerin erwartet, erläutert der scheidende Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor der Universitätsmedizin, Jochen A. Werner, im Interview.

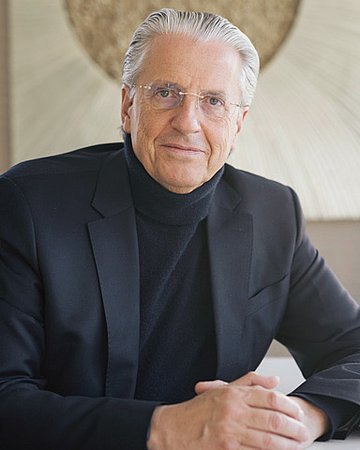
Herr Professor Werner, wie kam es vor zehn Jahren zur „digitalen Transformation“ der Universitätsmedizin Essen unter Ihrer Federführung?
Prof. Dr. Jochen A. Werner: Das Gesundheitssystem war bereits damals im Umbruch – es fehlte ein Konzept, um die Medizin effizienter, leistungsfähiger und gleichzeitig menschlicher zu machen. Die Digitalisierung bot schon zu dieser Zeit eine große Chance, um diese Defizite signifikant zu minimieren. Und genau diese Vision habe ich dem Aufsichtsrat vorgestellt. Darüber hinaus fehlte für die Universitätsmedizin Essen, die über keine lange Tradition verfügt, ein gemeinsames Selbstverständnis, eine unverwechselbare und authentische DNA, auch als Alleinstellungsmerkmal gegenüber der starken Konkurrenz in räumlicher Nähe. Mit der Strategie des Smart Hospitals haben wir folglich nicht nur eine gemeinsame Zukunftsvision für die Universitätsmedizin Essen entwickelt, sondern auch die digitale Transformation mit dem Ziel einer menschlicheren Medizin eingeleitet.
Erklären Sie bitte noch einmal kurz, was genau ein „Smart Hospital“ ist.
Werner: Aus unserer Sicht ist ein Smart Hospital ein Krankenhaus, das den Menschen konsequent in den Mittelpunkt des Handelns stellt, als Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden. Um deren – auch individuellen – Belange und Ziele zu erreichen, wird Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) dort eingesetzt, wo es sinnvoll ist. Digitalisierung ist somit alles andere als der Selbstzweck eines Smart Hospitals, das über die Digitalisierung eine bessere und menschlichere Medizin anbietet. Die Digitalisierung ist dabei der entscheidende Hebel, um Abläufe und Prozesse zum Wohle aller derart zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu verbessern, dass der Arbeitsdruck auf das medizinische und pflegerische Personal verringert wird. So bleibt wieder mehr Zeit für den Kern unserer Arbeit: Die Interaktion und die persönliche Betreuung der uns anvertrauten Menschen.
„Es ist nicht die Zeit zum Mäkeln, sondern zum Machen.“
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Essener Universitätsklinikums (2015-2025)
Muss man den Prozess der Digitalisierung in den einzelnen Regionen im Zuge der Krankenhausreform koordinieren oder machen das die kooperierenden Kliniken, Netzwerke und Verbünde unter sich aus?
Werner: Es braucht Vorbilder und Modellprojekte, als solche verstehen wir uns. Aber ein Smart Hospital als Insellösung bringt uns nicht wirklich weiter. Es geht am Ende nicht nur darum, für mehr Effizienz in einem Krankenhaus – also auf Mikroebene – zu sorgen, sondern gleichermaßen auch auf Makroebene. Damit meine ich das Gesundheitssystem als Ganzes und somit auch die Schnittstellen zu anderen Leistungserbringern in der Gesundheitsversorgung. Eine leistungsfähige IT-Infrastruktur und auch die elektronische Patientenakte sind Grundlage für diese sektorenübergreifende Vernetzung. Und diese ist wiederum eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Strukturreform der Krankenhäuser. Insofern braucht es hier die sektorenübergreifende Koordination. Wer diese Interaktion moderiert, ist aus meiner Sicht zweitrangig
Was sind zurzeit die größten Herausforderungen im Krankenhauswesen – einmal für die großen Player, aber auch für kleinere Häuser?
Werner: Darüber lassen sich lange Abhandlungen schreiben. Ich nenne kurzgefasst den Fachkräftemangel, der kleinere Häuser in ländlichen Regionen und die Pflegeeinrichtungen noch härter trifft als einen Maximalversorger im Ballungsgebiet. Der Fachkräftemangel ist nicht mehr aufzuhalten. Gleiches gilt für die Unterfinanzierung, die sich dramatisch verschärft und mit der nicht nur alle Leistungserbringer in der Medizin, sondern auch alle anderen Systeme der sozialen Sicherung zu kämpfen haben. Für die Universitätskliniken gilt, dass sie den Spagat zwischen Hochleistungsmedizin, Forschung und Lehre meistern müssen. Und das oft ohne adäquate Gegenfinanzierung.
Nicht zu unterschätzen ist zudem die aktuell unsichere politische Lage. Wir haben einerseits ein Vakuum an konsequentem Handeln, bedingt durch die vorgezogenen Wahlen. Andererseits eine weltpolitische Situation, die die finanzielle Schieflage des Gesundheitssystems wahrscheinlich noch verschärfen wird. Hinzu kommt, dass die Patientenfälle komplexer werden und damit die Behandlungsqualität höher werden muss. Das liegt unter anderem am demografischen Wandel. Wir brauchen interdisziplinäre, sektorenübergreifende Behandlungspfade und eine engere Verzahnung mit dem ambulanten Bereich. Umso bedrohlicher ist daher der Digitalisierungs-, Entbürokratisierungs- und Modernisierungsstau, der immer noch an vielen Stellen zu finden ist.
Universitätsmedizin Essen
Zur Universitätsmedizin Essen gehören das Universitätsklinikum sowie 15 Tochterunternehmen wie der Grund- und Regelversorger St. Josef Krankenhaus im Stadtteil Werden, die Ruhrlandklinik als Lungenfachklinik sowie das Westdeutsche Zentrum für Protonentherapie (WPE). Damit ist die Universitätsmedizin Essen der bedeutendste Gesundheitsversorger im Ruhrgebiet.
Was ist bei Ihnen in NRW anders als in einer Großstadt wie München?
Werner: Das ist ein guter Vergleich, denn er macht die unterschiedlichen Versorgungsrealitäten und Rahmenbedingungen deutlich und zeigt damit auf, wie schwierig es am Ende auch ist, eine bundesweite Reform umzusetzen. NRW ist vor allem in unserem originären Einzugsbereich „Ruhrgebiet“ immer noch ein Land im Strukturwandel. Wir sind das bevölkerungsreichste und ein besonders vielfältiges Bundesland, was die Bevölkerungsstruktur angeht.
Durch unsere Urbanität verfügen wir über eine relativ hohe Dichte an Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Beide Beispiele eint ihr Hintergrund als Metropolregion. Die Herausforderungen im ländlichen Bereich sind völlig andere. Für alle Rahmenbedingungen muss die Gesundheitspolitik passende Lösungen finden. Um auf die Unterschiede zur Großstadt wie München zurückzukommen: Hier will ich die aktuelle Umsetzung der Krankenhausreform in Nordrhein-Westfalen nennen. Grundsätzlich unterstützen wir die Anstrengungen von Karl-Josef Laumann, dem Gesundheitsminister in NRW, im Rahmen seiner Krankenhausreform. Diese wird sicherlich nicht nur Gewinner der Veränderung produzieren, aber für eine zukunftsfeste Gesundheitsversorgung braucht es auch Einschnitte, die vielleicht schmerzen. Was allerdings bei der aktuell ablaufenden Reform in die falsche Richtung geht, und wovon Bayern hoffentlich lernen dürfte, das ist die Gleichsetzung von Krankenhausreform und Universitätsklinikreform.
Was bedeutet das konkret?
An einer Universitätsklinik geht es eben ganz erheblich um Lehre und Forschung, um die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, einschließlich der Spezialisierung von Weiterbildungsassistentinnen und Weiterbildungsassistenten. Das schließt Fächer ein, die an vielen anderen Krankenhäusern in der zur vernünftigen Weiterbildung erforderlichen Tiefe überhaupt nicht vorhanden sind. Und dann trifft diese Komplexität auch noch auf das große Gebiet der universitätsmedizinischen Forschung, die über Jahrhunderte Treiber von medizinischen Innovationen war und auch sein wird. In NRW haben die Krankenhausverfahren vor Universitätskliniken keinen Halt gemacht. Dies ist ein deutlicher Fehler des Projektes.
„Kliniken sind das Rückgrat der medizinischen Versorgung in unserem Land.“
Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Essener Universitätsklinikums (2015-2025)
Wo sehen Sie im Hinblick auf die Krankenhausreform noch Handlungsbedarf beziehungsweise was ist aus Ihrer Sicht gut und was ist falsch gelaufen?
Werner: Die Krankenhausreformen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene adressieren richtigerweise zentrale strukturelle Probleme. Das reicht von der ungleichen Verteilung medizinischer Leistungen und Versorgungseinrichtungen über falsche Anreize für die Leistungserbringer bis hin zur fehlenden Spezialisierung und wirtschaftlichen Schieflage vieler Kliniken. Zudem fehlt es an Transparenz und Sicherheit, und zwar im Hinblick auf die Finanzierung in der Übergangszeit. Auch bleibt unklar, wie Grund-, Notfallversorgung und universitäre Spitzenmedizin ineinandergreifen sollen, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber es ist nicht die Zeit zum Mäkeln, sondern zum Machen. Die Stoßrichtung beider Reformanstrengungen geht in die absolut richtige Richtung und hat daher unsere Unterstützung. Ich denke, man muss sich von der Vorstellung lösen, dass ein über Jahrzehnte nicht stringent gewachsenes, sondern gewuchertes Gesundheitssystem mit zahlreichen Interessenlagen gleichsam über Nacht harmonisch und ohne Verwerfungen reformiert werden kann.
Wie wird die deutsche Krankenhauslandschaft im Jahr 2050 aussehen?
Werner: Ein wünschenswerter Idealzustand: Im Krankenhaus der Zukunft hat man sich schon länger von der alleinigen Funktion als Reparaturbetrieb verabschiedet und versteht sich als Einrichtung, die Patienten dabei berät und unterstützt, ein gesundheitsbewusstes Leben zu führen. Nicht zuletzt dank digitaler Systeme und KI gab es seit den 2030er Jahren deutlich mehr Raum für Empathie, Wertschätzung und Respekt als heute. Ein solches smartes, humanes Hospital konnte es aber nur geben, weil es zunehmend auch smarte, das heißt informierte, Patienten gab. Gesundheit und Gesunderhaltung wurden nicht nur seitens der Leistungserbringer im Gesundheitssystem neu gedacht, sondern auch von den Leistungsempfängern. KI-basierte personalisierte Prävention über persönliche KI-Assistenten ist nicht mehr weg denkbar. Ohne deutlich mehr Eigenverantwortung konnte es diese Entwicklung bis 2050 nicht geben.
Was uns aber schon heute im Krankenhaus stärker befassen sollte, ist das Thema Nachhaltigkeit in der Gesundheitsversorgung. Klimaschutz ist bekanntlich Gesundheitsschutz. Als medizinische Zentren verbrauchen Kliniken naturgemäß viel Energie. Sie gehören mit bis zu acht Tonnen Abfall täglich zu den größten Müllproduzenten unseres Landes. Als derart signifikante Emittenten müssen Kliniken umdenken und Wege zu mehr Nachhaltigkeit gehen. Also sollte, nein, muss das Krankenhaus der Zukunft auch ein Green Hospital sein.
Was sollte die neue Gesundheitsministerin am dringlichsten angehen?
Werner: Den Bürokratieabbau und den Digitalisierungsstau. Das gilt aber nicht nur für die neue Gesundheitsministerin, sondern ebenso für viele andere Ressorts. Die Handlungsfelder der künftigen Gesundheitspolitik lassen sich auf vier zentrale Prinzipien herunterbrechen: smart, economic, green und human. Es geht darum, durch konsequente Digitalisierung sowie sinnvolle Ökonomie mit Blick auf das Patientenwohl die stationäre Gesundheitsversorgung wieder menschlicher und auch nachhaltiger zu machen. Hierfür habe ich den Begriff „Kleeblattklinik“ geprägt, getragen auf den genannten vier Säulen. Kliniken sind das Rückgrat der medizinischen Versorgung in unserem Land. Sie haben enorme Abstrahleffekte auf das gesamte Gesundheitssystem. Es liegt in der Hand der neuen Ministerin, welchen Impuls ein modernes Gesundheitssystem liefern kann.
Bald gehen Sie in Pension und treten somit in eine neue Lebensphase ein – haben Sie hier schon Ideen für neue Projekte?
Werner: Aber selbstverständlich. Das Problem ist nicht die Anzahl an Ideen, sondern eher die Frage, welche Vorhaben ich wie und in welcher Reihenfolge in die Realität umsetzen kann. Aber eines steht bereits jetzt fest: Ich werde mit ganzer Kraft, wenn auch in anderer Position, weiterhin an der Fortentwicklung des Gesundheitssystems mit der Fokussierung auf mehr Menschlichkeit durch Digitalisierung und KI arbeiten.
Zur Person
Prof. Dr. Jochen A. Werner (Jahrgang 1958) ist Hals-Nasen-Ohren-Arzt und war in seiner Laufbahn im Management zahlreicher deutscher Kliniken tätig. Außerdem hatte er Gastprofessuren in den USA und China inne. Von 2015 bis zu seinem Ruhestand im Frühjahr 2025 war Werner Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Essener Universitätsklinikums.
Mitwirkende des Beitrags

Autorin





Datenschutzhinweis
Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.