Mehr Fairness nach Fehlern
Falsch dosierte Medikamente, im Bauchraum vergessene Tupfer oder Infektionen infolge mangelnder Hygiene: Behandlungsfehler können für Patientinnen und Patienten gravierende Folgen haben. Doch bei der Durchsetzung von Rechten nach erlittenen Schäden hapert es gewaltig. Die AOK mahnt einmal mehr Reformen an.

Rund 17,5 Millionen stationäre Krankenhausfälle verzeichneten die 1.841 Kliniken in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2024. Aus wissenschaftlichen Studien ist bekannt, dass es in etwa einem Prozent aller stationären Behandlungen zu Fehlern und vermeidbaren Schäden kommt. Demnach waren allein im stationären Bereich im Jahr 2024 rund 175.000 Patientinnen und Patienten von einem Behandlungsfehler betroffen. Doch die wenigsten Fälle treten ans Licht: Experten gehen davon aus, dass nur etwa drei Prozent aller unerwünschten Ereignisse nachverfolgt werden.
Beweislast ist ungerecht verteilt
Die Hauptursache dafür liegt in der schwachen Rechtsposition der Geschädigten, die insbesondere durch Informations- und Wissensdefizite, die enorm hohe und ungerecht verteilte Beweislast, die lange Verfahrensdauer und die hohen Kosten eines gegebenenfalls erforderlichen Rechtsstreits begründet ist. Daran hat auch das Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten (Patientenrechtegesetz) im Jahr 2013 nichts geändert.
Denn mit dem Patientenrechtegesetz sind lediglich die Rechte und Pflichten kodifiziert worden, die sich aus dem Behandlungsvertrag für Behandelnde sowie für Patientinnen und Patienten ergeben. Auf dem Weg zu einem Mehr an Transparenz und Rechtssicherheit war dies zwar ein erster wichtiger Schritt, aber eben nur der erste.
Normen statt Almosen
Seit Jahren drängen unterschiedliche Akteure im Gesundheitswesen auf eine weitreichende Reform des Patientenrechtegesetzes. Trotz dieser Forderungen und der Absichtserklärungen politisch Verantwortlicher hat sich fast nichts geändert. Dabei ist eine umfängliche Verbesserung der Rechtsposition von Patienten dringend erforderlich.
Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze, hatte seine Forderungen für ein Patientenrechtestärkungsgesetz im Zusammenhang mit dem zehnjährigen Bestehen des Patientenrechtegesetzes im Jahre 2023 formuliert – nichts davon gelangte in den Gesetzgebungsprozess oder gar in die Umsetzung. Auch die amtierende Regierung hat sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, bei medizinischen Behandlungen Patienten gegenüber den Behandelnden stärken zu wollen. Nach mehr als 100 Tagen im Amt gibt es aktuell keine Hinweise, wann entsprechende Gesetzesentwürfe angegangen werden sollen.
Entsprechende Forderungen und Vorschläge dazu, was in welcher Norm wie anzupassen ist, hatte die AOK-Gemeinschaft im Jahr 2019 und erneut im Jahr 2021 für Behandlungs- und Pflegefehler sowie für Arzneimittel- und Medizinproduktschäden den jeweiligen Koalitionären unterbreitet. Die Ortskrankenkassen sind mit ihren Lösungsvorschlägen dem Gedanken mehrerer Regierungen entgegengetreten, einem Teil der Betroffenen über einen sogenannten Härtefallfonds lediglich Almosenzahlungen zukommen zu lassen. Geschädigte brauchen vielmehr suffiziente gesetzliche Normen zur Durchsetzung sämtlicher berechtigter Schadenersatzansprüche.
Positionen für Patienten

2025 haben die AOKs diese Forderungen nochmals mit Schilderungen ihrer Versicherten und den Erfahrungen in der Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen bei Behandlungs- und Pflegefehlern sowie bei Arzneimittel- und Medizinprodukteschäden abgeglichen. Darauf aufbauend hat die AOK-Gemeinschaft mit den im September 2025 veröffentlichten „AOK-Positionen zur Stärkung der Rechte von Patientinnen und Patienten bei Behandlungs- und Pflegefehlern sowie Arzneimittel- und Medizinprodukteschäden“ klare Botschaften an die politisch Verantwortlichen gerichtet. Eine der Kernforderungen ist dabei die Absenkung der Beweislast. Die EU-Kommission hatte schon 1990 einen Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über die Haftung bei Dienstleistungen – auch im Gesundheitsbereich – vorgelegt, die eine Verschuldenshaftung mit einer Umkehr der Beweislast vorsah. Nach ablehnenden Reaktionen, insbesondere aus der Wirtschaft, zog die Kommission im Jahr 1994 diesen Vorschlag wieder zurück.
In Deutschland müssen geschädigte Patienten den Vollbeweis dafür führen, dass ein Fehler unterlaufen ist, dass ein Schaden entstanden ist und dass zwischen Fehler und Schaden Kausalität besteht. Insbesondere mit Blick auf das Wissensgefälle zwischen Behandelnden und ihren Patienten ist offensichtlich, dass sich diese nicht in gleichwertigen Rechtspositionen gegenüberstehen. Dies könnte der Gesetzgeber mit Regelungen ändern, nach denen der Beweis für die Kausalität zwischen Fehler und Schaden als geführt gilt, wenn der Ursachenzusammenhang mit mehr als 50 Prozent überwiegend wahrscheinlich ist. Dies würde der Beweisposition entsprechen, die sich grundsätzlich aus dem Vertragsrecht für Geschädigte ergibt. Die diesem Grundsatz widersprechenden Sonderregelungen für den Behandlungsvertrag sind nicht nur systemwidrig. Sie schwächen massiv die Rechtsposition von Patienten in Deutschland.
Auch der Patientenbeauftragte der Bundesregierung setzt sich seit Jahren für eine Senkung des Beweismaßes hinsichtlich der Kausalität zwischen Fehler und Schaden ein – von der richterlichen Überzeugung auf die überwiegende Wahrscheinlichkeit.
Schutz vor IGeL-Risiken
Mit Blick auf das stetig wachsende Angebot selbst zu zahlender individueller Gesundheitsleistungen (IGeL) muss seitens des Gesetzgebers der Tatsache begegnet werden, dass Behandelnde ihre Patientinnen und Patienten nicht immer so ausreichend über Behandlungen und deren mögliche Folgen informieren, dass diese eine überlegte Entscheidung treffen können. Zwar regelt Paragraf 630e Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), dass über die Art, den Umfang, die Durchführung, die zu erwartenden Folgen und Risiken der Maßnahme sowie über ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie aufzuklären und auch auf Alternativen hinzuweisen ist. In der medizinischen Praxis bestehen hier aber bei individuellen Gesundheitsleistungen erhebliche Defizite.
Selbst wenn medizinische Fachgesellschaften von bestimmten IGeL vor dem Hintergrund möglicher Schädigungen der Patienten abraten, werden diese Leistungen bis dato in großem Umfang verkauft. Nach dem IGeL-Report 2024 gaben gesetzlich Versicherte mindestens 2,4 Milliarden Euro für IGeL aus. Deren möglicher Schaden kann den Nutzen aber deutlich überwiegen, beispielsweise bei vielfach falsch-positiven Ergebnissen und dadurch bedingten unnötigen weiteren Untersuchungen und Eingriffen. Zum Schutz der Patientinnen und Patienten ist daher eine gesetzliche Klarstellung dahingehend erforderlich, dass die Behandelnden auch über den medizinischen und individuellen Nutzen sowie über das individuelle Schadensrisiko der angebotenen Behandlung informieren müssen und dies zu dokumentieren haben.
Einsichtnahme erleichtern
Hegen Patientinnen oder Patienten den Verdacht eines Behandlungsfehlers, ist die Einsichtnahme in die Behandlungsunterlagen unerlässlich. Das Recht auf Einsichtnahme in die Patientenakte ist nicht nur grundgesetzlich garantiert. Durch die EU-Datenschutzgrundverordnung wurden Patientinnen und Patienten erstmals europaweit einheitlich in der Selbstbestimmung und Kontrolle über ihre Daten gestärkt. In der Praxis berichten Betroffene gleichwohl von Problemen: Ihnen wird die Einsichtnahme gänzlich verwehrt oder sie erhalten nur Teile ihrer Behandlungsunterlagen. Hier bedarf es der Normierung von Sanktionen. Das schont auch Ressourcen von Gerichten, die diesen Klagen regelmäßig stattgeben.
Darüber hinaus muss der Gesetzgeber durch eine Erweiterung des Einsichtsrechts dem Umstand Rechnung tragen, dass ein Teil der Informationen, die Patienten für die Prüfung von etwaigen Standardverstößen und nachfolgenden Schadenersatzansprüchen benötigen, nicht Bestandteil der patientenindividuellen Akte ist. Dies sind zum Beispiel Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Einhaltung von Hygienevorschriften stehen. Auch das Medizinproduktebuch, das Aufzeichnungen über den Nachweis der Funktionsprüfungen von medizinischen Geräten, Protokolle der Einweisung von Anwendenden sowie über Kontrollen und Instandsetzungsmaßnahmen bis hin zu Meldungen von Vorkommnissen enthält, ist kein Bestandteil der individuellen Akte.
Weitere für die Patientinnen und Patienten notwendige Informationen ergeben sich aus den Meta-Daten der Patientenakte, also ihren spezifischen Änderungs- und Speicherdaten. Da sich diese Eintragungen unmittelbar auf Inhalte der Patientenakte beziehen, erstreckt sich das Einsichtsrecht auch hierauf. In der Praxis bestehen aber erhebliche rechtliche Unsicherheiten, sodass es dringend einer gesetzlichen Klarstellung bedarf.
Die AOK-Gemeinschaft hatte 2019 und 2021 gefordert, dass die Behandelnden den Patienten auf Wunsch die Kopie der Behandlungsunterlagen kostenlos bereitstellen. Der Europäische Gerichtshof hat im Jahr 2023 entschieden, dass die erste Abschrift der Patientenakte kostenlos zur Verfügung zu stellen ist. Aufgabe des Gesetzgebers ist es, die dieser Rechtsprechung widersprechende Norm des Paragrafen 630g Absatz 2 Satz 2 BGB entsprechend einem Gesetzentwurf aus dem Bundesjustizministerium abzuändern.
„Wirtschaftlichen Schaden begrenzen“
Susanne Wagenmann, alternierende Aufsichtsratsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes und Arbeitgebervertreterin:
„Die AOK-Gemeinschaft unterstützt ihre Versicherten bei Verdacht auf einen Behandlungsfehler mit einem professionellen Behandlungsfehler-Management. Durch Behandlungsfehler entstehen Leid bei den Betroffenen und Folgekosten für die Gemeinschaft der Beitragszahlenden. Den Betroffenen helfen die AOKs bei der außergerichtlichen Geltendmachung ihrer Ansprüche. Um den wirtschaftlichen Schaden für die Versichertengemeinschaft zu begrenzen, macht die AOK im Zuge von Regressforderungen die zusätzlichen Kosten konsequent geltend – 2024 waren es fast 50 Millionen Euro."
Haftpflicht ausreichend versichern
Zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen aus Behandlungs- und Pflegefehlern sowie von Arzneimittel- und Medizinprodukteschäden ist die Zahlungsfähigkeit des Anspruchsgegners beziehungsweise eine die Schäden ausreichend abdeckende Haftpflichtversicherung unerlässlich. Daher hatte die AOK-Gemeinschaft in ihren Vorschlägen zur Stärkung der Patientenrechte 2019 und 2021 die Schaffung gesetzlicher Regelungen für ausreichende Pflichtversicherungen aller Behandelnden im Gesundheitswesen empfohlen.
Mit dem Gesundheitsversorgungs-Weiterentwicklungsgesetz hat der Gesetzgeber im Jahr 2021 neben der bereits bestehenden berufsrechtlichen Pflicht eine vertragsärztliche Verpflichtung normiert, sich gegen die sich aus ihrer Berufsausübung ergebenen Haftpflichtgefahren zu versichern. Nach der Gesetzesbegründung soll mit der Versicherungspflicht die Realisierbarkeit von Schadenersatzansprüchen und Regressforderungen in Fällen von Behandlungsfehlern gestärkt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es aber nicht nur dringend geboten, die Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung auf alle Behandelnden auf bundesgesetzlicher Ebene auszuweiten und dabei auch Krankenhäuser und Krankenhausträger zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es notwendig, Mindestversicherungssummen festzulegen, die an den tatsächlichen Schäden und an der Schadensentwicklung orientiert sind. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Kreis derjenigen, die medizinische Leistungen erbringen und keine ärztliche Ausbildung absolviert haben, wie beispielsweise Pflegeassistenzpersonen und Apothekerinnen und Apotheker, zunehmend größer wird. Auch die Tätigkeiten dieser Berufsgruppen müssen für entstehende Schäden von einem ausreichenden Versicherungsschutz mit einer gesetzlichen Regelung von tragfähigen Mindestversicherungssummen flankiert sein.
Aber auch der überlangen Verfahrensdauer, bis Betroffene ihre berechtigten Schadensersatzansprüche durchsetzen können, muss der Gesetzgeber begegnen. Sinnvoll sind hier insbesondere die Festlegung von Standards für medizinische Gutachten, die Stärkung des Parteisachverständigen, die Einrichtung von Spezialkammern für Medizinprodukteschadensfälle bei den Gerichten und die Stärkung der Mediation. Ein überlanges Verfahren stellt aus Sicht der Autoren dieses Artikels eine Verletzung des Grundgesetzes und der Europäischen Menschenrechtskonvention dar und ist damit rechtswidrig.
„Patientenrechte weiterentwickeln“
Knut Lambertin, alternierender Aufsichtsratsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes und Versichertenvertreter:
„Im Rahmen des Behandlungsfehler-Managements sind den elf AOKs allein 2024 insgesamt 16.660 neue Fälle von vermuteten Behandlungs- oder Pflegefehlern bekannt geworden. In Behandlung sind die Patientinnen und Patienten eher mit Gesundung beschäftigt als mit der Frage, ob Fehler geschehen. Das gilt auch für deren Angehörige. Gleichzeitig fühlen sich viele Menschen im Umgang mit Leistungserbringern ohnmächtig oder weniger kompetent. Daher benötigen wir eine Weiterentwicklung der Patientenrechte, damit die Menschen ihre Rechte besser durchsetzen können."
Kassenbefugnisse stärken
Für die ersten Schritte in der Verfolgung von Schadenersatzansprüchen, die aus Behandlungs- und Pflegefehlern resultieren, sind die Krankenkassen wichtige Ansprechpartner für ihre Versicherten. Die AOK unterstützt Betroffene seit 25 Jahren unter anderem bei der Beschaffung von Behandlungsunterlagen, bei der medizinischen und juristischen Bewertung der Behandlungsabläufe sowie im Rahmen der außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen. Mit Blick auf die große Zahl von Patientinnen und Patienten mit Arzneimittel- und Medizinprodukteschäden ist es an der Zeit, dass der Gesetzgeber den Krankenkassen eine rechtssichere Möglichkeit gibt, ihre Versicherten auch in solchen Fällen zu unterstützen.
Um Betroffene, die fast immer medizinische Laien sind, überhaupt in die Lage zu versetzen, Behandlungsabläufe auf mögliche Standardverstöße zu prüfen, müssen die Behandelnden sie informieren. Der Gesetzgeber muss Behandelnde grundsätzlich dazu verpflichten, ihre Patienten über die Annahme eines Behandlungsfehlers beziehungsweise die Möglichkeit eines drittverursachten Schadens, beispielsweise durch den Hersteller eines Arzneimittels, eines Medizin- oder Blutprodukts, zu informieren. Bei Sicherheitshinweisen oder Rückrufen für Medizinprodukte ist häufig eine zügige Abstimmung zwischen den Patientinnen und Patienten und ihren Behandelnden zum weiteren Behandlungsverlauf erforderlich, um einen möglichen gesundheitlichen Schaden abzuwenden. Um sämtliche Betroffene ermitteln zu können, ist es dringend geboten, für die Krankenkassen eine Regelung zu schaffen, nach der die Produktinformationen routinemäßig und verpflichtend in die Abrechnungsdaten der Ärztinnen und Ärzte sowie der Krankenhäuser aufzunehmen sind.
Um gegebenenfalls Schadenersatzansprüche geltend machen zu können, ist auch bei Medizinprodukteschäden die Kenntnis des Anspruchsgegners zwingend erforderlich. Es müssen daher Regelungen geschaffen werden, die vorsehen, dass diese Informationen mit dem Inverkehrbringen eines Produktes den Patienten zur Verfügung stehen.
Ob bei Arzneimittel- und Medizinprodukteschäden oder Schäden durch Behandlungsfehler: Patientinnen und Patienten sitzen heute bei der Anerkennung und Durchsetzung ihrer Ansprüche meist am kürzeren Hebel. Der Gesetzgeber muss endlich nachsteuern, um Opfern von Fehlern in der Medizin zu ihrem Recht zu verhelfen.
Mitwirkende des Beitrags

Autorin

Autor



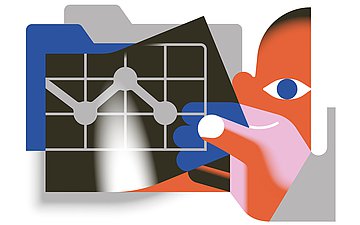
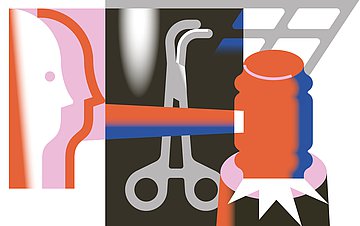

Datenschutzhinweis
Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.