G+G Wissenschaft: Von der Nuss im Tontopf zur niedrigeren Pflegewahrscheinlichkeit
Soziale Ungleichheit nimmt seit einigen Jahren wieder zu. Das spiegelt sich in der Gesundheit der Bevölkerung. Die neue G+G Wissenschaft bündelt, was wir zum Thema wissen und skizziert Problemlösungen.

Soziale Ungleichheit ist so alt wie der Überfluss: Als die ersten Menschen verstanden, dass man gerade nicht benötigte Dinge aufbewahren und bei Bedarf gegen andere Dinge oder gegen Dienstleistungen tauschen konnte, entstand auch die Ungleichheit zwischen den Menschen. Ein Beispiel macht das klar: Wer aus Mangel notorisch zu wenige Kalorien zu sich nimmt, denkt kaum daran, ein paar Nüsse oder Weizenkörner in einem Tontopf zu verstauen, um sie später zu konsumieren oder gar anderweitig zu nutzen. Erst einmal muss man mehr haben, als man gerade zum Überleben braucht. Angeblich war das vor etwa 13.000 Jahren im östlichen Mittelmeerraum der Fall. Vorher waren die Menschen, abgesehen von ihren biologischen Unterschieden, wohl ziemlich gleich. Anthropologen verweisen als Beleg darauf, dass auch heute noch existierende Kulturen von Sammlern und Jägern betont flache Hierarchien haben.
Ziemlich zackige Kurve
Will man eruieren, wie ungleich Menschen im Laufe der Geschichte waren, hängt das Ergebnis stark von den betrachteten Zeiträumen und den gewählten Kriterien für Ungleichheit ab. Mit wunderbaren Zahlen ab dem 19. Jahrhundert, insbesondere zum oft gewählten Kriterium Einkommen, wartet die von renommierten Wissenschaftlern betriebene Internetseite World Inequality Data auf – interaktiv und auswählbar nach Ländern. Eine der Grafiken zeigt den Anteil, den die obersten zehn Prozent der Bevölkerung zwischen 1820 und 2020 vor Steuern am Volkseinkommen in Deutschland hatten. 1820 waren das 47 Prozent, 2019 nur noch 36,8 Prozent. Bei einer Senkung um zehn Prozentpunkte könnte man sich zurücklehnen und sagen: „Na prima, es geht in die richtige Richtung.“ Geht es aber nicht, wenn man genauer hinschaut: 1982 war der Wert bereits bei 27,4 Prozent, seitdem steigt er – nicht linear, sondern in einer ziemlich zackigen Kurve.
Warum sollte uns das als Zeitschrift mit gesundheitspolitischer Ausrichtung bewegen? Nun, es ist klar erwiesen, dass Gesundheit und soziale Ungleichheit in einer engen Wechselwirkung stehen. Um es etwas holzschnittartig zu skizzieren: je tiefer auf der sozialen Leiter man steht, desto mehr hat man mit bestimmten Krankheiten zu tun, desto früher ist man pflegebedürftig und desto früher stirbt man – jedenfalls im Durchschnitt. Umgekehrt gilt: Je kränker und pflegebedürftiger man ist, desto schwieriger ist die soziale Teilhabe – vom sozialen Aufstieg ganz zu schweigen. Wenn also die soziale Ungleichheit seit einiger Zeit wieder zunimmt, darf uns das nicht egal sein.
Ideologischer Überbau
Bevor man Veränderungen zum Besseren einleiten kann, muss man wissen, wo man steht. Das ist nicht trivial, denn soziale Ungleichheit ist im Laufe der Geschichte immer wieder in wirkmächtige politische Narrative eingebettet gewesen. Erschwerend kommt hinzu: Ein gewisses Mindestmaß an Ungleichheit ist erwünscht, nur streiten sich die Gelehrten, wie hoch es sein soll.
Wer soziale Ungleichheit aufrechterhalten will, muss sie verargumentieren und zur Not mit Gewalt und Unterdrückung verteidigen. Wie das Despoten im 20. Jahrhundert gelungen ist, hat Frank Dikötter in seinem Buch „Diktator werden“ aufgearbeitet. Und John Rawls benennt in seiner „Theorie der Gerechtigkeit“ die ebenfalls wirkmächtige These des kapitalistischen Wachstums, nämlich dass auch die relativ gesehen ärmsten Schichten profitieren, wenn die Eliten in einem Maße dazu verdienen, dass sie wirtschaftliches Wachstum befördern – und damit ebenfalls die soziale Ungleichheit.
Nüchterne Übersicht
Ziel und Zweck dieser G+G Wissenschaft ist daher, eine betont nüchtern-wissenschaftliche Übersicht zu geben darüber, was wir zurzeit wissen über soziale Ungleichheit im Zusammenhang mit Gesundheit. Da das Thema äußerst vielschichtig ist, haben wir neben einer Übersichtsanalyse zwei exemplarische Detailanalysen in Auftrag gegeben, nämlich zum einen zum Komplex Pflegerisiko und Lebenserwartung und zum anderen zu Bewegung. Unsere Autoren zeigen in ihren Beiträgen auch – das gehört zu wissenschaftlicher Redlichkeit dazu –, welche Teilthemen noch wenig oder gar nicht bearbeitet sind. Skizziert werden zudem Lösungen zur Eindämmung übermäßiger sozialer Ungleichheit beziehungsweise ihrer Folgen für die Gesundheit.
Mitwirkende des Beitrags

Autorin





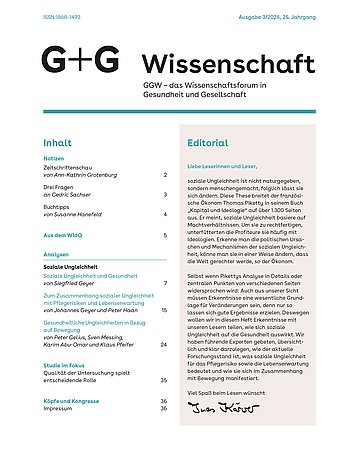
Datenschutzhinweis
Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.