„Osteoporose bleibt stumm – bis der Knochen bricht.“
Wie kommen Menschen mit Osteoporose schneller in die richtige Therapie? Orthopäde Dr. Stephan Quest erklärt, wie strukturierte Abläufe die Versorgung verbessern – und was Patientinnen und Patienten konkret davon haben.
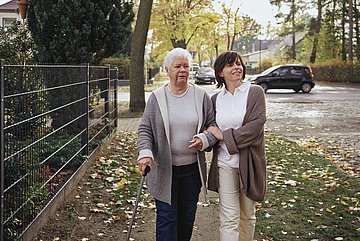
Herr Dr. Quest, wann denken Sie bei Knochenbrüchen an Osteoporose – und was bedeutet die Diagnose für Betroffene?
Ich denke immer dann an Osteoporose, wenn der eigentliche Auslöser für den Schaden viel zu klein ist – ein Stolperer, eine Bagatelle – und trotzdem kommt es zum Bruch. Osteoporose bleibt lange stumm - viele merken sie erst nach dem ersten Bruch. Für Betroffene bedeutet das oft Unsicherheit im Alltag und die Sorge vor weiteren Frakturen.
Der neue Gesundheitsatlas Osteoporose zeigt, dass die Erkrankung weit verbreitet ist. Wer ist besonders häufig betroffen?
Jede dritte Frau über 50 und etwa jeder fünfte Mann über 50 erleidet im Laufe des Lebens eine osteoporotische Fraktur – etwa einen Wirbel-, Schenkelhals- oder Unterarmbruch. Vor allem Frauen ab etwa 70 Jahren sind davon betroffen. Auch bei Männern sehe ich einen Gipfel in höherem Alter, bei jüngeren Männern oft mit Begleiterkrankungen wie Rheuma. Die Diagnose verunsichert, weil man weitere Brüche und den Verlust an Selbstständigkeit fürchtet.
Wie stellen Sie die Diagnose – und was hat sich in der Praxis bewährt?
Wir beginnen mit einem strukturierten Patientengespräch: Risiken, Sturzursachen, Vorerkrankungen. Dann erfolgt das Röntgen der betroffenen Region, ein Labor und eine Knochendichtemessung. Am Ende steht die Risikoeinschätzung für Frakturen – und davon hängt die Therapie ab. Bei hohem Risiko starten wir medikamentös, um Knochenabbau zu bremsen und die verbleibende Knochenmasse zu stabilisieren.
Was können Betroffene selbst tun?
Kurz: „Wer rastet, der rostet“ – das gilt bei Osteoporose ganz besonders. Deshalb ist es für Betroffene wichtig, sich zu bewegen – und zwar mit kurzen, klaren Belastungsreizen für den Knochen. Alles, was „den Knochen arbeiten lässt“, hilft; natürlich angepasst an Alter und Fitness. Wer kann, profitiert von kürzeren, kräftigen Impulsen wie beim Krafttraining. Für viele Ältere ist Regelmäßigkeit das Wichtigste. Ich verordne oft Funktionstraining: fester Termin, Anleitung, Austausch – das motiviert. Im Alltag wirkt auch längeres und häufiges Gehen mit festen Zielmarken. Die Bewegung im Freien verbessert zudem den Blutdruck, die Immunabwehr und unterstützt die körpereigene Vitamin-D-Bildung.
Seit Kurzem gibt es das Disease-Management-Programm (DMP) Osteoporose. Warum schreiben Sie viele Patientinnen und Patienten in das Programm ein?
Weil Osteoporose zu lange als Alterserscheinung abgetan wurde. Dieses DMP verkürzt Wege zwischen Haus- und Facharzt Will ein Arzt nach erfolgter Approbation eine Fachgebietsbezeichnung (zum Beispiel Arzt für… , wir sprechen häufiger direkt miteinander, und die Patientinnen und Patienten sind besser informiert. So diagnostizieren wir früher und therapieren konsequenter. Meine Motivation ist klar: sensibilisieren – idealerweise vor dem ersten Bruch. Zurückliegend betrachtet hat sich viel getan: Die erste deutsche Leitlinie kam 2005; heute denke ich, wir brauchen ein selbstverständliches Screening – etwa Frauen ab 70, Männer ab 80 Jahren – um früh gegenzusteuern.
Welche Vorteile spüren Patientinnen und Patienten im DMP Osteoporose?
Unsere Schulungen klären: Was bedeutet die Erkrankung für mich, welche Therapie passt, was kann ich selbst tun? Eine erfolgversprechende Osteoporose-Therapie ist aktiv und multimodal und bedeutet: nicht passiv behandelt werden. Viele merken: Ich kann viel selbst beitragen – durch Bewegung, Ernährung und das Dranbleiben an Medikamenten. Dieses Gefühl stärkt das Selbstbewusstsein und verbessert die Therapietreue. In der Sprechstunde spüren wir: Die Leute fragen gezielter nach und nutzen auch das Info-Material.
Und Prävention – was lohnt sich wirklich?
Es lohnt sich, früh mit Bewegung anzufangen und ausgewogene, kalziumreiche Ernährung zu sich zu nehmen. Kalzium steckt zum Beispiel in Milchprodukten, grünem Gemüse und dunklen Brotsorten. Später geht es um Koordination, Kraft und Sturzprophylaxe – und um Rauchstopp. Ausdauer ist gut; für den Knochenaufbau bringen kurze, intensive Belastungen meist mehr als sehr lange Einheiten. Von extremen Ultradistanzen wie bei einem Marathon rate ich vielen ab. Wichtig ist: aktiv bleiben – über das ganze Leben hinweg.


