G+G Wissenschaft: Mit Lego zur Erleuchtung
Versorgungsqualität lässt sich messen – und das sogar, ohne bei den Leistungserbringern zusätzliche Zahlen zu erheben. Was wir über unser Gesundheits- und Pflegesystem mithilfe bereits vorhandener Daten sagen und wie wir diese noch besser einsetzen können, klären die Autoren der neuen G+G Wissenschaft.

Vor einigen Jahren hatte der amerikanische Design-Professor Leidy Klotz eine Erleuchtung. Er spielte gerade mit seinem Sohn mit Legosteinen. Genauer: Die beiden bauten eine Brücke. Einer der zwei Stützpfeiler war kürzer als der andere. Während Klotz nach einem passenden Legostein suchte, um den kürzeren Pfeiler zu verlängern, schnappte sich sein Sohn einfach die Brücke und nahm auf der längeren Seite einen Stein weg. Danach war die Länge der Pfeiler identisch und die Brücke eine veritable Brücke.
Klotz erkannte: Er hatte einen zu engen Problemlösungsansatz gewählt, denn die Möglichkeit, einen Stein wegzunehmen, hatte er gar nicht in Betracht gezogen. Der Designer fragte sich verblüfft, ob andere Menschen auch erst einmal dächten, man müsse etwas hinzufügen, wenn man ein Problem lösen wollte. Er tat sich mit anderen Wissenschaftlern zusammen und machte dazu empirische Experimente. Die bestätigten seine Ahnung. Ja, der Mensch neigt zum Hinzufügen, insbesondere, wenn er gestresst ist. Klotz verfasste über die Ergebnisse nicht nur vielbeachtete Forschungsartikel, sondern gleich ein ganzes Buch, das unter dem Titel „Substract – The Untapped Science of Less“ erschienen ist.
Hinzufügen ist leichter, Wegnehmen ist oft besser
Zu den Erkenntnissen des Wissenschaftlers von der University of Virginia gehört auch: Hinzufügen erscheint oft einfacher, ist aber nicht unbedingt sinnvoller beziehungsweise es schafft andere Probleme. Manchmal ist Wegnehmen die bessere Option, allerdings ist es oft auch mit mehr Denken und/oder mehr Tun verbunden. Beispiel: die Person, die vorm übervollen Kleiderschrank steht und meint, sie hätte nichts anzuziehen. Der Reflex ist: losziehen und einkaufen. Dabei wäre es vielleicht viel sinnvoller (und ökonomischer und ökologischer), alte, nicht mehr passende Kleidung auszusortieren und nur noch die Kleidungsstücke im Schrank zu haben, die man auch wirklich trägt. Die sieht man in einem entsprechend aufgeräumten Schrank tatsächlich sofort, wenn man die Tür öffnet. Man greift dann schnell zu etwas, das man gerne trägt – Problem gelöst.
Manchmal ist es übrigens auch das Beste, genau mit dem zu arbeiten, was man hat, also nichts hinzuzufügen oder wegzunehmen. Bestes Beispiel dafür sind Puzzle. Das Ergebnis wird eher schlechter, wenn man der Gesamtzahl der Teile eines wegnimmt oder eines zu ihr hinzufügt.
Gesundheitswesen neigt zur Addition
Was das Ganze mit dem Gesundheitswesen zu tun hat? Auch hier sollte man immer wieder reflektieren, welcher Ansatz der beste ist. Denn das Gesundheitswesen neigt ebenfalls mit einem gewissen Automatismus zum Hinzufügen: Vorschriften werden mehr und detaillierter, das ganze System wird ständig komplexer. Bürokratieabbau wird zwar immer wieder gefordert, aber so richtig viel getan hat sich bisher nicht, eben weil Entrümpeln oft (gedanklich) aufwendig ist.
Bewusst gegen das Hinzufügen entschieden hat sich vor einigen Jahren das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO), als es begann, Routinedaten zu nutzen, um die Qualität von Leistungen zu ermitteln, zunächst im Krankenhaus- und später auch Pflegebereich. Das WIdO fragt also keine zusätzlichen Daten ab und vermehrt damit den Dokumentationsaufwand, sondern es wertet die Daten aus, auf die es ohnehin zugreifen kann, etwa weil sie bei der Abrechnung von Leistungen verwendet werden. Was sich damit erreichen lässt, wurde am 10. September bei einem Symposium deutlich, das zu Ehren von Jürgen Klauber in Berlin stattfand. Klauber war mehr als 20 Jahre Geschäftsführer des WIdO und ging kürzlich in den Ruhestand. Ihm und seinen Mitstreitern ist maßgeblich zu verdanken, dass die Arbeit mit Routinedaten im deutschen Gesundheitswesen, wie er selbst in der G+G Wissenschaft formuliert, inzwischen „politischer Mainstream“ ist.
Symposium zum Nachlesen
Anlässlich des Symposiums hat die Redaktion der G+G Wissenschaft einige Referenten der Veranstaltung sowie weitere Experten gebeten, in insgesamt drei Analysen darzulegen, wie Deutschland inzwischen in Sachen Versorgungsqualität dasteht. In der aktuellen Ausgabe nehmen Katharina Achstetter, Miriam Blümel, Philipp Hengel und Reinhard Busse einen detaillierten Vergleich mit anderen Ländern vor. Deutschland kann zwar mit guter sogenannter Responsiveness punkten, unser System ist aber immer noch geprägt durch hohe Kosten und eine überdurchschnittliche vermeidbare Sterblichkeit. Reinhard Busse nimmt in einem weiteren Aufsatz die Krankenhausreform unter die Lupe und zeichnet nach, wie sie verändert und verwässert wurde – was seiner Ansicht nach in vielerlei Hinsicht der Versorgungsqualität eher abträglich ist. Heinz Rothgang zeigt in seiner Analyse, dass derzeit bei der Pflege die gleichen Qualitätsindikatoren für Qualitätssicherung und -entwicklung genutzt werden, warum das aus seiner Perspektive kontraproduktiv ist und was man stattdessen machen sollte. Mehrere Texte zum Thema Qualitätsmessung in Deutschland aus dem WIdO runden das Heft ab.
Mitwirkende des Beitrags

Autorin





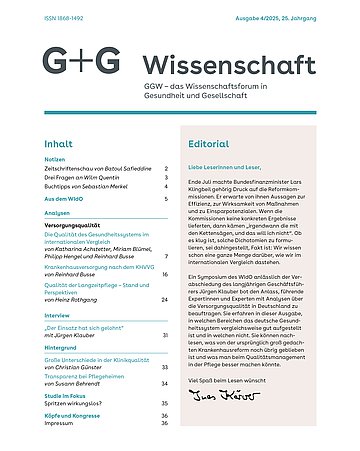
Datenschutzhinweis
Ihr Beitrag wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion auf anstößige Inhalte überprüft. Wir verarbeiten und nutzen Ihren Namen und Ihren Kommentar ausschließlich für die Anzeige Ihres Beitrags. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, sondern lediglich für eventuelle Rückfragen an Sie im Rahmen der Freischaltung Ihres Kommentars verwendet. Die E-Mail-Adresse wird nach 60 Tagen gelöscht und maximal vier Wochen später aus dem Backup entfernt.
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung und zu Ihren Betroffenenrechten und Beschwerdemöglichkeiten finden Sie unter https://www.aok.de/pp/datenschutzrechte. Bei Fragen wenden Sie sich an den AOK-Bundesverband, Rosenthaler Str. 31, 10178 Berlin oder an unseren Datenschutzbeauftragten über das Kontaktformular.