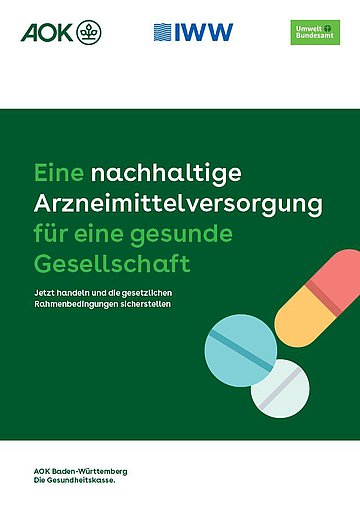Hohe Antibiotikakonzentrationen in Gewässern nachgewiesen
AOK, IWW und UBA aktualisieren Studienergebnisse zur nachhaltigen Arzneimittelversorgung

Stuttgart. Antibiotikaresistenzen entwickeln sich zu einer der gravierendsten Bedrohungen für die medizinische Versorgung und führen weltweit zu einer hohen Zahl an vorzeitigen Todesfällen. Um dieser Entwicklung frühzeitig und systematisch zu begegnen, initiierte die AOK Die AOK hat mit mehr als 20,9 Millionen Mitgliedern (Stand November 2021) als zweistärkste Kassenart… -Gemeinschaft 2020 unter Führung der AOK Baden-Württemberg eine Studie zur ökologischen Nachhaltigkeit in der Antibiotikaversorgung in Kooperation mit dem IWW Institut für Wasserforschung und dem Umweltbundesamt. Nachdem erste Ergebnisse 2023 präsentiert wurden, legen die Projektpartner nun ein aktualisiertes Policy Paper vor. „Die Ergebnisse aus fünf Jahren Forschungsarbeit zeichnen ein klares Bild: In jeder zweiten untersuchten Produktionsstätte wurden Antibiotikabelastungen nachgewiesen, die Resistenzbildung begünstigen. Das zeigt eindeutig, wie dringend wir handeln müssen – und dass politische Entscheidungsprozesse dieses Thema nicht länger ausklammern dürfen“, fordert Johannes Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg.
Als bundesweite Verhandlungsführerin für die Arzneimittelrabattverträge Seit Inkrafttreten des Beitragssatzsicherungsgesetzes 2003 und erweitert durch das… der AOK-Gemeinschaft implementierte die AOK Baden-Württemberg 2020 erstmals ein optionales Nachhaltigkeitskriterium in die Ausschreibung für Antibiotika, um Anreize für deren umweltgerechte Produktion zu schaffen. So können pharmazeutische Unternehmen bei der Vergabe einen Bonus auf ihr Angebot erhalten, wenn sie sich freiwillig verpflichten, wirkungsbasierte Maximalkonzentrationen im Produktionsabwasser einzuhalten. Die Einhaltung wird durch die Entnahme und Analyse von Proben bei den Wirkstoffherstellern vor Ort durch Expertinnen und Experten des IWW vorgenommen. Im Auftrag der AOK-Gemeinschaft wurden bis heute an über 22 Standorten in China, Indien und Europa Messungen durchgeführt und Wasserproben auf die im Abwasser enthaltenen Antibiotika-Konzentrationen geprüft. Zudem wurden Gewässerproben der durch die Produktionsstätten beeinflussten Umwelt auf Antibiotika untersucht sowie oberflächlicher, auf dem Werksgelände kontaminierter Geländeabfluss, in die Analyse einbezogen. „Eine verlässliche Arzneimittelversorgung gelingt langfristig nur, wenn wir wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung konsequent zusammendenken. Als Gesellschaft stehen wir hier gemeinsam in der Pflicht – und wir müssen dieser Verantwortung endlich gerecht werden“, betont Bauernfeind.
Im Produktionsabwasser wurde die höchste Konzentration bei Levofloxacin gemessen. Der Messwert von > 600 μg/l überschritt den vertraglich vereinbarten Schwellenwert um mehr als das 2.500-fache. Auch andere Überschreitungen in Produktionsabwässern lagen zum Teil in Größenordnungen von mehreren Tausendfachen der Schwellenwerte. Auch die unmittelbare Umwelt ist mit hohen Antibiotikakonzentrationen belastet. Insgesamt wurden von den Prüferinnen und Prüfern 26 verschiedene Antibiotika in Umweltproben festgestellt. Von den insgesamt 14 beprobten Gewässern, wiesen nur 4 keine besorgniserregende Antibiotikakonzentration auf. Die höchste Überschreitung in allen Proben bisher, wurde in einem Oberflächenabfluss beim Antibiotikum Clindamycin festgestellt. Die unabhängigen Prüferinnen und Prüfer konnten hier eine Konzentration von ~180000 μg/l feststellen. Die Konzentration überschritt den vorgegebenen Schwellenwert von 0,4 μg/l damit um mehr als das 4.500.000-fache (!).
„Der Nachweis teils hoher Antibiotikakonzentrationen in Gewässern, die durch Produktionsstätten beeinflusst sind – einschließlich oberflächlich ablaufenden Regenwassers, die direkt in die Umwelt führen – ist höchst besorgniserregend. In einigen Fällen fließen diese Gewässer durch Weideflächen und Wohngebiete. Das hat direkte Auswirkungen auf Mensch und Natur“, ordnet Bauernfeind die Studienergebnisse ein. Allerdings zeige sich im Untersuchungszeitraum auch der positive Effekt der Forschungsarbeit: „Durch die Probenentnahmen und den direkten Austausch mit den Vertretern des IWW vor Ort konnte das Wissen über die umweltkritischen sowie gesundheitsgefährdenden Auswirkungen der Produktion nachweislich erweitert werden. In einigen Regionen hat dies bereits dazu geführt, dass Produktionsabwasser besser aufbereitet wird. Zudem beobachten wir, dass Hersteller zunehmend voneinander lernen und Verbesserungen in weiteren Werken umgesetzt werden.“
Eigenerklärung führen nicht zum Ziel
Bauernfeind fordert als Rückschluss auf die Studienergebnisse eine größere europäische Kraftanstrengung: „Wer Antibiotikaresistenzen ernsthaft bekämpfen will, muss an der Wurzel ansetzen. Dafür brauchen wir verbindliche regulatorische Vorgaben – und zwar auf europäischer Ebene, damit der gesamte europäische Markt Gewicht entfalten kann. Nur so lassen sich die Risiken für Umwelt und Gesundheit spürbar reduzieren.“ Zielführend seien verpflichtende Umweltkriterien in der Arzneimittelversorgung – sowohl für den Erhalt einer Zulassung Die Berechtigung, zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Leistungen zu erbringen, setzt… als auch für die laufende Produktion. Zudem brauche es europaweit einheitliche Kontrollsysteme. Hersteller müssten verpflichtet werden, ihre Wirkstoffproduktion einer unabhängigen Kontrolle zu unterziehen und entsprechende Audit- und Zertifizierungsnachweise vorzulegen. „Eigenerklärungen führen nicht zum Ziel. Die Studie zeigt deutlich, dass viele Wirkstoffhersteller ihre Situation falsch einschätzen. Trotz vertraglich vereinbarter Messungen wurden teilweise gravierende Überschreitungen der zulässigen Wirkstoffwerte festgestellt – und das bei freiwilliger Teilnahme. Wahrscheinlich sehen wir nur einen Bruchteil des tatsächlichen Problems“, hebt Bauernfeind hervor.
Als Schritt in die richtige Richtung bewertet Bauernfeind das EU-Pharma-Paket, welches einige Akzente im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen setze. Es reiche jedoch nicht, um die Ursache wirklich anzugehen – weder bei den europaweiten Lieferengpässen noch beim Thema der ökologischen Nachhaltigkeit: „Wir brauchen verbindlichere Vorgaben. Dazu gehören umfassende Transparenz über das Liefergeschehen durch ein umfassendes Frühwarnsystem sowie verpflichtende Umweltkriterien und klare Prüfmechanismen.“