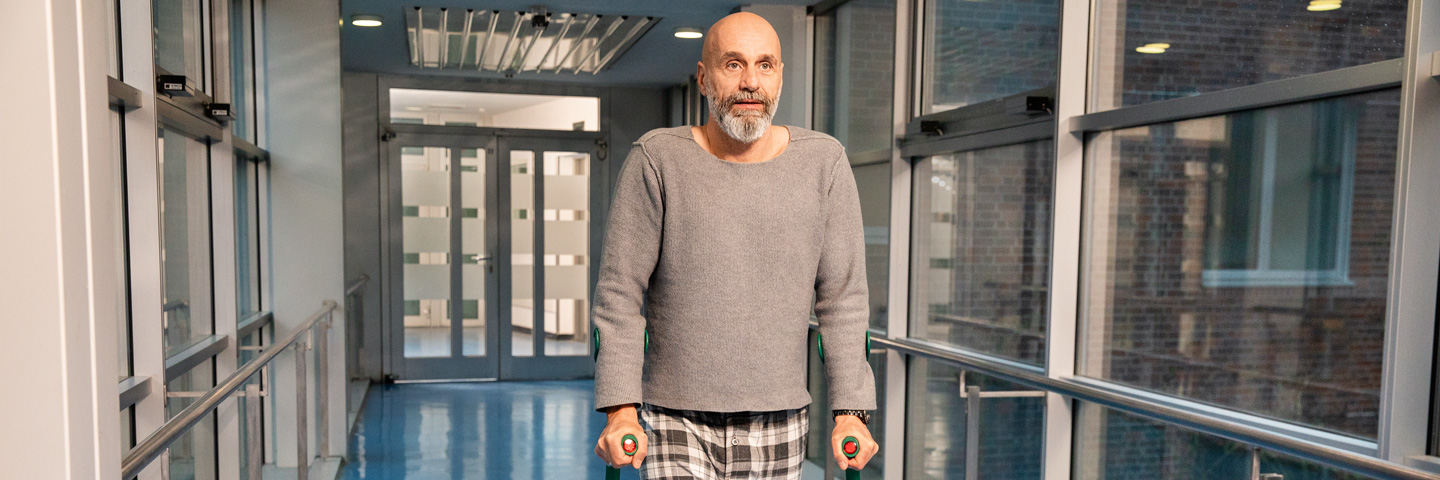Anspruchsvoraussetzungen für Entgeltfortzahlung
Der Entgeltanspruch eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin bleibt grundsätzlich bis zur Dauer von sechs Wochen erhalten, wenn er oder sie durch eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit unverschuldet daran gehindert wird, die Beschäftigung auszuüben. Dieser Grundsatz ist im Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) geregelt. Hier finden sich auch weitere Voraussetzungen und Besonderheiten.
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung setzt ein bestehendes Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis voraus. Grundlage ist der Abschluss eines Arbeits- beziehungsweise Ausbildungsvertrags. Sind Beschäftigte zum Ende eines Arbeitsverhältnisses arbeitsunfähig, erlischt mit diesem Zeitpunkt in aller Regel auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung.
Arbeitsverhinderung und Ursache der Arbeitsunfähigkeit
Beschäftigte erhalten immer dann Entgeltfortzahlung, wenn sie wegen Krankheit arbeitsunfähig sind. Die Ursache der Krankheit ist – abgesehen vom Selbstverschulden – ohne Bedeutung. Die Entgeltfortzahlung ist somit auch dann zu leisten, wenn die Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Berufskrankheit oder eines Sport-, Verkehrs- oder sonstigen Unfalls eintritt.
Arbeitsunfähigkeit liegt dann vor, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin daran gehindert ist, die bisherige Berufstätigkeit auszuüben. Das gilt auch, wenn dies nur unter der Gefahr der Verschlimmerung möglich wäre. Eine bestehende Arbeitsunfähigkeit stellt die Ärztin oder der Arzt fest.
Beispiel: Eine angestellte Opernsängerin ist heiser
Die Opernsängerin kann bei Heiserkeit den geplanten Auftritt nicht wahrnehmen. Sie ist arbeitsunfähig.
Eine angestellte Reinigungskraft, die ebenfalls heiser ist, kann trotzdem ihre vereinbarte Reinigungstätigkeit ausüben. Sie ist nicht arbeitsunfähig.
Seit 1. Juli 2022 stellen die Krankenkassen die Daten über die Arbeitsunfähigkeit elektronisch (eAU-Verfahren) für den Abruf durch die Arbeitgeber zur Verfügung.
Seit 1. Januar 2023 ist der Abruf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitbescheinigung (eAU-Verfahren), für alle Arbeitgeber obligatorisch. Die Vorlage einer Papierbescheinigung durch den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ist seit diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgesehen.
Kein Selbstverschulden
Beschäftigte haben nur dann einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn sie an der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit kein Selbstverschulden trifft.
Für das Vorliegen einer selbst verschuldeten Arbeitsunfähigkeit gilt im Entgeltfortzahlungsgesetz ein eigenständiger Begriff: Sie liegt nur bei einem groben Verstoß gegen das von einem verständigen Menschen im eigenen Interesse zu erwartende Verhalten vor. Dies bedeutet, dass nicht schon jede leichte Fahrlässigkeit bei der Entstehung einer Krankheit als Verschulden zu betrachten ist. Beweislast für das Vorliegen von Selbstverschulden trägt im Allgemeinen der Arbeitgeber.
Beispiel: Ein Arbeitnehmer erkältet sich
Ein Arbeitnehmer erkältet sich, weil er im Regen spazieren gegangen ist. Eine aus diesem Verhalten resultierende Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers ist nicht selbst verschuldet.
Die Rechtsprechung beurteilt regelmäßig bei verschiedenen Sachverhalten, ob Selbstverschulden vorliegt. Hiernach liegt grundsätzlich ebenfalls kein Selbstverschulden vor bei:
- Trunkenheit und Sucht
- Selbsttötungsversuch
- Sportunfall
Dagegen kann Selbstverschulden – vorbehaltlich einer Einzelbeurteilung – angenommen werden bei:
- einer tätlichen Auseinandersetzung, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sie provoziert oder begonnen hat
- einer Verletzung der Unfallverhütungsvorschriften
- Missachtung einer ärztlichen Anordnung und pflichtwidrigem Verhalten
- Verkehrsunfällen, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Pflichten als Verkehrsteilnehmende verstoßen hat (zum Beispiel Trunkenheitsfahrt)
Schwangerschaftsabbruch, Sterilisation, Organspende, Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahme
Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit gilt auch eine Arbeitsverhinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht rechtswidrigen Abbruchs der Schwangerschaft eintritt. Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht auch bei Arbeitsunfähigkeit infolge der Spende von Organen oder Geweben. Dies gilt ebenso bei medizinischen Maßnahmen zur Vorsorge oder Rehabilitation. Voraussetzung ist hierbei, dass die Maßnahme von einem Sozialleistungsträger (zum Beispiel von einer Krankenkasse, einem Träger der Rentenversicherung oder einem Unfallversicherungsträger) bewilligt worden ist und in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird.
Ende der Wartezeit bei neuen Arbeitsverhältnissen
Bei neu begründeten Arbeitsverhältnissen entsteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall erst nach vierwöchiger, ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses (Wartezeit). Beschäftigte, die in den ersten vier Wochen des Arbeitsverhältnisses erkranken, haben also erst ab Beginn der fünften Woche Anspruch auf die sechswöchige Entgeltfortzahlung. Während der Wartezeit ist die finanzielle Absicherung in aller Regel durch die Krankenkasse gewährleistet. In Tarifverträgen kann von der vierwöchigen Wartezeit abgesehen werden (zum Beispiel im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst).
Für den Entgeltfortzahlungsanspruch ist es nicht erforderlich, dass die Beschäftigung bereits aufgenommen wurde. Wenn die Arbeitsunfähigkeit nach Abschluss des Arbeitsvertrags, aber vor der vereinbarten Arbeitsaufnahme eintritt, beginnt die vierwöchige Wartezeit mit dem Tag der vereinbarten Arbeitsaufnahme. Nach der Wartezeit entsteht der Anspruch auf Entgeltfortzahlung bis zur Dauer von sechs Wochen.
Beispiel: Entgeltfortzahlung vor Arbeitsbeginn
| Abschluss Arbeitsvertrag | 1.8. |
| Vereinbarte Arbeitsaufnahme | 1.9. |
| Arbeitsunfähigkeit | 11.8. bis 9.11. |
Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht vom 29.9. bis 9.11.