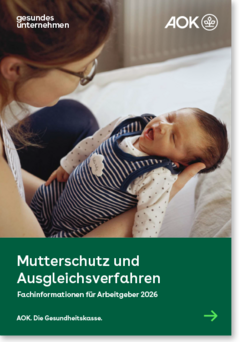Mutterschutzfrist vor und nach der Geburt
Sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstag besteht ein gesetzliches Beschäftigungsverbot. Für die Berechnung der Schutzfrist ist der mutmaßliche Entbindungstag maßgebend, den Arzt, Ärztin oder Hebamme bescheinigen. Bei der Berechnung des Beginns der Schutzfrist wird der Entbindungstag als Ereignistag nicht mitgerechnet. Die Schutzfrist endet also stets am Tag vor der Geburt.
Nach der Geburt gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot von acht Wochen. Das bedeutet: Auch wenn die Arbeitnehmerin es wünscht, darf der Arbeitgeber sie nicht beschäftigen.
Wird das Kind vor dem mutmaßlichen Entbindungstag geboren, verkürzt sich die Schutzfrist vor der Geburt und verlängert sich entsprechend um diesen Zeitraum nach der Geburt. Kommt das Kind hingegen später als erwartet zur Welt, verlängert sich die Schutzfrist vor der Geburt bis zur tatsächlichen Entbindung – die Schutzfrist nach der Geburt bleibt davon unberührt. Die Gesamtdauer des Mutterschutzes beträgt dadurch immer mindestens 99 Tage. Der Tag der Geburt wird als Ereignistag nicht in diese Wochenfristen eingerechnet.
Beispiel: Schutzfristen bei Geburt vor dem errechneten Termin
Linn Schmidt sollte am 2.11. voraussichtlich entbinden. Tatsächlich kommt das Kind am 31.10. zur Welt (keine Mehrlings- oder Frühgeburt).
Tatsächlicher Entbindungstermin: 31.10.
Beginn der Schutzfrist vor der Geburt: 21.9.
Schutzfrist nach Geburt: 8 Wochen (= 56 Kalendertage)
1.11. + 56 Kalendertage = 26.12.
Aufgrund der zeitlich früheren Geburt verlängert sich die Schutzfrist um 2 Tage: 28.12.
Erster Arbeitstag für Linn Schmidt ist der 29.12.
Gesamte Schutzfrist 21.9. bis 28.12. = 99 Tage
Beispiel: Schutzfristen bei Geburt nach dem errechneten Termin
Marie Lu sollte am 1.11. voraussichtlich entbinden. Tatsächlicher Geburtstermin ist der 4.11.
Tatsächlicher Entbindungstermin: 4.11.
Beginn der Schutzfrist vor der Geburt: 20.9.
Schutzfrist: 8 Wochen (56 Kalendertage)
Ende der Schutzfrist: 30.12.
5.11. + 56 Kalendertage = 30.12.
Aufgrund der zeitlich späteren Geburt verlängert sich die Schutzfrist vor der Geburt um 3 Tage: 30.12.
Erster Arbeitstag für Marie Lu ist der 31.12. (wenn nicht arbeitsfrei)
Schutzfrist 20.9. bis 30.12. = 102 Tage
Verlängerte Mutterschutzfrist nach der Geburt
Die Schutzfrist nach der Geburt verlängert sich immer dann auf zwölf Wochen, wenn
- das Kind als Frühgeburt auf die Welt kam oder
- eine Mehrlingsgeburt vorliegt oder
- wenn bei dem Kind innerhalb der ersten acht Wochen nach der Entbindung eine Behinderung festgestellt wurde (Verlängerung der Schutzfrist nur auf Antrag der Mutter).
Ob es sich um eine Frühgeburt handelt, stellen Arzt beziehungsweise Ärztin oder Hebamme fest. Die Krankenkasse informiert den Arbeitgeber über die Verlängerung der Schutzfrist.
Mutterschutz bei Fehlgeburt und Totgeburt
Seit dem 1. Juni 2025 haben Frauen bei einer Fehlgeburt ein Recht auf Mutterschutz:
- Ab der 13. Schwangerschaftswoche: 2 Wochen
- Ab der 17. Schwangerschaftswoche: 6 Wochen
- Ab der 20. Schwangerschaftswoche: 8 Wochen
Es handelt sich um eine Totgeburt, wenn ein Kind mit mindestens 500 Gramm Geburtsgewicht oder ab der 24. Schwangerschaftswoche im Mutterleib verstirbt. In diesen Fällen gilt eine Schutzfrist von acht Wochen. Ein Anspruch auf verlängertes Mutterschaftsgeld für Früh- oder Mehrlingsgeburten besteht bei einer Totgeburt nicht.
Die Mutterschutzfrist beginnt am Tag nach der Entbindung beziehungsweise nach der Fehlgeburt. Um mutterschutzrechtliche Leistungen zu erhalten, muss die Betroffene den Arbeitgeber zeitnah in Kenntnis setzen. Als Nachweis über die Tot- beziehungsweise Fehlgeburt, erhält die Beschäftigte eine ärztliche Bescheinigung („Muster 9“). Diese dient als Antrag auf Mutterschaftsgeld nach einer Fehlgeburt und enthält eine Ausfertigung zum Nachweis für den Arbeitgeber.
Arbeiten während der Mutterschutzfrist
Eine Arbeitnehmerin kann auf die gesetzliche sechswöchige Schutzfrist vor der Geburt sowie auf die Schutzfristen nach einer Fehlgeburt auf eigenen Wunsch verzichten und sich ausdrücklich zur Arbeitsleistung bereit erklären. Bei einer Totgeburt gilt das ebenfalls, aber erst ab der dritten Woche nach der Entbindung. Diese Erklärung kann sie aber jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Während der acht- beziehungsweise zwölfwöchigen Schutzfrist nach einer normalen Geburt gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot. Arbeitgeber dürfen die Arbeitnehmerin in dieser Zeit nicht beschäftigen, auch nicht, wenn die Frau dies explizit wünscht.
Kündigungsverbot für Schwangere und junge Mütter
Arbeitgeber dürfen – bis auf wenige Ausnahmen – das Beschäftigungsverhältnis von Schwangeren sowie jungen Müttern nicht kündigen.
Das Kündigungsverbot gilt vom Beginn der Schwangerschaft an bis zum Ablauf von vier Monaten
- nach der Entbindung,
- nach einer Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche,
- nach einer Totgeburt.
Trotz dieses Kündigungsverbots kann das Arbeitsverhältnis im Einzelfall enden beziehungsweise beendet werden. So ist die Arbeitnehmerin nicht vor der Beendigung ihres Arbeitsvertrags aus anderen Gründen geschützt, beispielsweise bei
- Nichtigkeit oder Anfechtung des Arbeitsvertrags oder
- Beendigung des Arbeitsvertrags durch Zeitablauf (Befristung).
In besonderen Einzelfällen bleibt eine Kündigung durch den Arbeitgeber möglich. Das kann zum Beispiel bei Gründen vorliegen, die eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Die zuständige Landesbehörde muss eine solche Kündigung aber für zulässig erklären.
Der Arbeitnehmerin steht es jedoch frei, auf den Kündigungsschutz zu verzichten und so die Kündigung durch den Arbeitgeber wirksam werden zu lassen. Da Arbeitnehmerinnen ihr Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft freiwillig beenden können, sind auch Aufhebungsverträge grundsätzlich zulässig. Der Mutterschutz endet dann zusammen mit dem Arbeitsverhältnis.