Lebensmittel
Alkoholfreies Bier, Wein oder „Mocktails“: nicht automatisch gesund
Veröffentlicht am:13.08.2025
6 Minuten Lesedauer
Alkoholfreie Alternativen zu Bier, Wein, Sekt oder Spirituosen werden immer beliebter. Doch wie gesund sind diese Getränke wirklich? Und wer sollte auch von alkoholfreien Drinks lieber die Finger lassen?
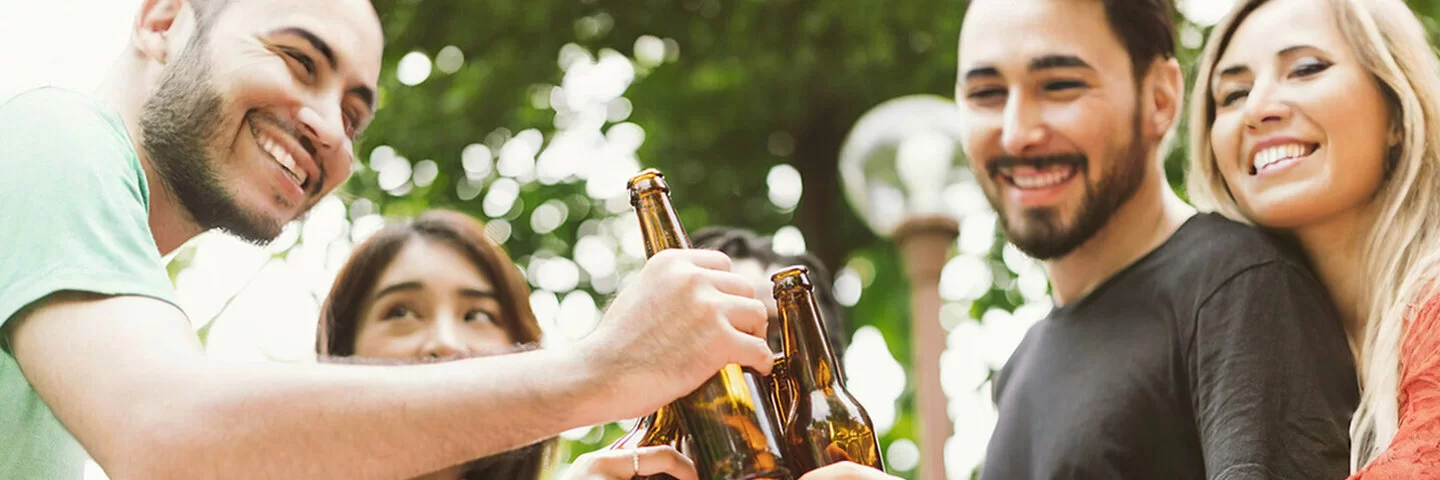
© iStock / pondsaksit
Alkoholfreie Trendgetränke als Alternative zum Alltagskonsum
Das Gläschen Sekt zum Anstoßen, der Rotwein zum guten Essen oder das Bier in geselliger Runde: Alkohol ist Teil unserer Alltagskultur. Andererseits ist Alkohol eine Droge und ein Nervengift. Regelmäßiger Konsum kann zu Alkoholsucht führen und selbst geringe Mengen sind schädlich für die Gesundheit. Aus diesem Grund gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit 2024 keine Höchstmenge für den täglichen Alkoholkonsum mehr an, die als gesundheitlich unbedenklich gelten kann. Stattdessen empfiehlt die DGE, ganz auf alkoholische Getränke zu verzichten. Aus rein gesundheitlicher Sicht ist das nur konsequent. Es existiert schließlich auch kein gesundheitlich unbedenklicher Grenzwert für das Rauchen.
Es gibt also gute Gründe, auf Alkohol zu verzichten. Einige Menschen wollen gar nicht erst damit anfangen, andere wollen ihren Konsum begrenzen und Menschen mit Alkoholsucht müssen komplett auf Alkohol verzichten. Doch nicht alle möchten deshalb nur noch Wasser, Schorlen oder Softdrinks trinken, sondern auch ohne Alkohol den typischen Geschmack alkoholischer Getränke genießen. Entsprechend wächst das Angebot an alkoholfreiem Bier, Wein, Sekt und Spirituosenimitaten. Mit letzteren lassen sich alkoholfreie Cocktails, sogenannte Mocktails, mixen, die ihren alkoholischen Vorbildern geschmacklich sehr nahekommen.
Was ist der Unterschied zwischen „alkoholfrei“ und „ohne Alkohol“?
„Alkoholfrei“ bedeutet nicht 0,0 Prozent. Alkoholfreies Bier darf noch bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol enthalten. Biere, die mit den Formulierungen „ohne Alkohol“ oder „0,0 % vol Alkohol“ beworben werden, dürfen hingegen überhaupt keinen Alkohol enthalten.
Das gilt für Wein und Sekt genauso: Solange der Alkoholgehalt nicht über 0,5 Volumenprozent liegt, dürfen sie sich „alkoholfrei“ nennen. Spirituosenersatz gilt rechtlich als „nicht-kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk“ und darf ohne Kennzeichnung bis zu 0,25 Volumenprozent Alkohol enthalten. Die Angabe „ohne Alkohol“ ist auch in diesen Fällen nur zulässig, wenn der Alkoholgehalt tatsächlich 0,0 Volumenprozent beträgt.
Übrigens: Selbst Fruchtsäfte gären leicht und enthalten deshalb Alkohol. Zum Zeitpunkt der Abfüllung dürfen sie bis zu 0,38 Volumenprozent enthalten. In der Flasche können die Säfte weiter gären, wodurch der tatsächliche Alkoholgehalt ansteigen kann.
„Gesünder“ ist bei alkoholfreiem Bier oder Wein nicht gleich „gesund“
Ein alkoholfreies Getränk ist immer die gesündere Alternative zu einem alkoholhaltigen Getränk. Das gilt auch für Getränke mit einem Alkoholgehalt von unter 0,5 Volumenprozent. Bei einem so geringen Alkoholgehalt sind bei gesunden Erwachsenen keine gesundheitlichen Schäden durch den Konsum dieser Getränke zu erwarten. Schwangere müssen allerdings ganz auf Alkohol verzichten und wirklich ausschließlich Drinks genießen, die 0,0 Volumenprozent Alkohol enthalten. Und Kinder sollten niemals alkoholfreies Bier, Wein oder Mocktails trinken, damit sie sich gar nicht erst an den Geschmack gewöhnen.
Wer weniger Alkohol trinkt, senkt das Risiko für viele Erkrankungen
Aus medizinischer Sicht ist es daher grundsätzlich begrüßenswert, dass alkoholfreie Produkte zunehmend gefragt sind. Ein geringerer Alkoholkonsum reduziert nicht nur das Risiko einer Abhängigkeit, sondern auch das Risiko anderer Gesundheitsprobleme und Erkrankungen wie:
- Schlafstörungen
- Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich
- Lebererkrankungen wie Fettleber oder Leberzirrhose
- Probleme mit der kognitiven Leistungsfähigkeit
- psychische Probleme
Alkoholfreie Drinks am besten für besondere Anlässe vorbehalten
Andererseits gilt jedoch: „Gesünder“ dank fehlendem Alkohol bedeutet nicht automatisch „gesund“. Zuckerhaltige Softdrinks beispielsweise sind auch nicht gesund, nur weil sie keinen Alkohol enthalten. Tatsächlich hängt es stark vom jeweiligen Produkt ab. Es empfiehlt sich, die Nährwertkennzeichnung alkoholfreier Alternativen hinsichtlich des Zuckergehalts und weiterer Zusatzstoffe genau zu studieren. Eine sinnvolle Orientierungshilfe für den Alltag ist, Alkoholersatzprodukte einschließlich alkoholfreiem Bier genau wie ihre alkoholischen Vorbildgetränke nicht als Durstlöscher zu verwenden, sondern als Genussmittel für besondere Anlässe.
Wie alkoholfreie Biere, Weine und Spirituosen hergestellt werden
Beim alkoholfreien Bier gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze: die gestoppte Gärung und die nachträgliche Entfernung von Alkohol aus einem herkömmlich gebrauten Bier.
Bei der gestoppten Gärung wird der Gärungsprozess durch kurzes Erhitzen unterbrochen, bevor größere Mengen Alkohol entstehen können. Für den nachträglichen Entzug von Alkohol sind zwei Verfahren üblich: Die Vakuumdestillation entfernt den Alkohol aus dem konventionell gebrauten Bier, indem Alkohol bei vermindertem Druck verdampft. Unter geringerem Druck verdampft der Alkohol schon bei relativ niedrigen Temperaturen. Bei der sogenannten Umkehrosmose kommen spezielle Membranen zum Einsatz, die nur für Wassermoleküle durchlässig sind, nicht jedoch für aromatische Inhaltsstoffe und Alkohol. Die hierbei zurückgehaltenen Weinbestandteile mit den Geschmacksstoffen werden anschließend wieder mit der entalkoholisierten Flüssigkeit gemischt.
Um alkoholfreien Wein oder Sekt herzustellen, muss immer zuerst ein normaler Wein produziert werden, dem anschließend der Alkohol entzogen wird. In Deutschland ist die Vakuumdestillation das Standardverfahren bei Wein und Sekt.
Bei Spirituosenersatz ist die Herstellung von Fall zu Fall unterschiedlich. Manchmal wird den Spirituosen der vorhandene Alkohol entzogen, manchmal ahmen die Getränke mithilfe von Kräutern und Aromen den Geschmack der alkoholhaltigen Variante nach.
Passende Artikel zum Thema

© iStock / GMVozd
Wieviele Kalorien enthalten alkoholfreies Bier, Wein und Mocktails?
Alkoholfreies Bier wird auf verschiedene Weise hergestellt. Aus diesem Grund enthalten einige Sorten Zucker, während andere zuckerfrei sind. Alkoholhaltiges Bier enthält dagegen niemals Zucker, da der Malzzucker bei der Gärung von den Hefen vollständig in Alkohol umgewandelt wird. Bei Bieren mit gestoppter Gärung passiert das hingegen nur zu einem geringen Teil. Sie enthalten daher Zucker. Wird dem Bier nach dem Brauen der Alkohol entzogen – beispielsweise durch Vakuumdestillation –, ist auch im alkoholfreien Bier kein Zucker mehr enthalten.
Da Zucker einen hohen Energiegehalt hat, haben die alkoholfreien Biere je nach Zuckeranteil auch entsprechend Kalorien. Die Nährwertangaben auf der Flasche bieten hierüber Aufschluss.
Der Kalorien- und Zuckergehalt von alkoholfreien Weinen und Sekten variiert. Da Alkohol jedoch ein wichtiger Geschmacksträger ist, dürfen weinerzeugende Betriebe in Europa alkoholfreiem Wein beispielsweise Traubenmost hinzufügen, um den Alkohol als Träger von Aromen zu ersetzen. Das wirkt sich wiederum auf den Gesamtzuckergehalt aus. Auch hier lohnt es sich daher, einen Blick auf die Nährwertangaben zu werfen.
Wie viel Zucker in einem Spirituosenersatz enthalten ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Einige Drinks enthalten gar keinen Zucker, andere schon. Und wie hoch der Zuckergehalt individuell gemixter Mocktails in der Gastronomie ist, weiß nur der Barkeeper oder die Barkeeperin. Da zuckrige Cocktails für Menschen mit Diabetes problematisch sein können, empfiehlt es sich, beim Personal nachzufragen.
0,0-Prozenter mit Alkoholgeschmack: gefährlich bei Suchtproblemen
Ob „alkoholfreie” Getränke mit einem Alkoholgehalt von bis zu 0,5 Volumenprozent eine Gefahr für Menschen mit Alkoholproblemen darstellen, ist nicht eindeutig erforscht. Eine sichere Untergrenze, die bei trockenen Menschen mit Suchterkrankung einen Rückfall verhindert, lässt sich nicht festlegen.
Das ist aber auch gar nicht so entscheidend. Suchtkrankheiten haben neben der körperlichen auch eine psychische Seite. Insbesondere das starke Verlangen nach Alkohol lässt sich nicht auf die Wirkung des Nervengifts auf den Körper reduzieren. Alkoholfreie Varianten von Bier, Wein, Sekt oder Spirituosen sind dem Original geschmacklich sehr ähnlich. Bereits der Geruch kann das Belohnungssystem im Gehirn aktivieren und das Verlangen nach dem „echten“ Stoff wecken: ein starker Trigger, der einen Rückfall auslösen kann.
So können selbst tatsächliche Nullprozenter für Menschen mit Alkoholproblemen eine Gefahr darstellen. Diese Menschen sollten daher alle Getränke, die an Alkohol erinnern, meiden. Das bedeutet auch: Ein Fruchtsaft, der tatsächlich Alkohol enthält – wenn auch nur in sehr geringer Menge – ist für Menschen mit Suchtproblematik weniger gefährlich als ein alkoholfreies Imitat eines alkoholischen Drinks.
Die Inhalte unseres Magazins werden von Fachexpertinnen und Fachexperten überprüft und sind auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.








