Krebs
Aktinische Keratose – ein unterschätztes Risiko
Veröffentlicht am:22.10.2025
6 Minuten Lesedauer
Die aktinische Keratose ist eine Verhornung der Haut an Körperstellen, die dem UV-Licht der Sonne besonders intensiv ausgesetzt sind. Sie ist eine Krebsvorstufe, aus der weißer Hautkrebs entstehen kann. Lesen Sie hier, wie Sie sich schützen können.
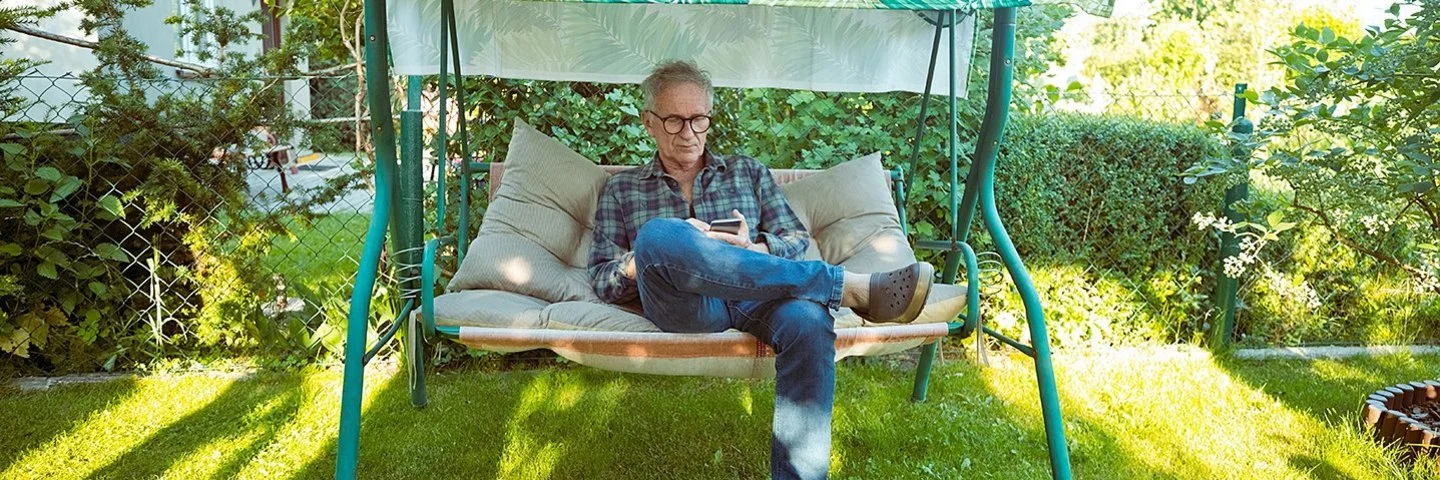
© iStock / izusek
Inhalte im Überblick
- Symptome: Was ist eine aktinische Keratose?
- Aktinische Keratose: Wer hat ein erhöhtes Risiko?
- Wie ist der Verlauf bei einer aktinischen Keratose?
- Diagnose: Wie wird eine aktinische Keratose erkannt?
- Therapie: Wie lässt sich eine aktinische Keratose behandeln?
- Prävention: Wie kann ich einer aktinischen Keratose vorbeugen?
Symptome: Was ist eine aktinische Keratose?
Die aktinische Keratose, auch „solare Keratose“ oder „Lichtkeratose“, umgangssprachlich „Sonnenwarzen“ genannt, ist eine sogenannte Hautkrebsvorstufe, genauer: eine Vorstufe des weißen Hautkrebses. Dabei treten unterschiedlich große, rötliche oder hautfarbene, teils schuppige Hautveränderungen auf, die sich beim Darüberstreichen oft rau oder wie Schleifpapier anfühlen.
Meist sind Körperpartien betroffen, die dem Sonnenlicht besonders ausgesetzt sind. Diese von Fachleuten auch als „Sonnenterrassen“ bezeichneten Areale sind vor allem das Gesicht (Stirn, Nase, Unterlippe, Ohren) sowie die Handrücken, Unterarme und die Kopfhaut bei einer Glatze. Eine aktinische Keratose auf den Lippen äußert sich über trockene Schuppungen oder schlecht heilende Wunden vorwiegend auf der Unterlippe und heißt in der Fachsprache Cheilitis actinica.
Bilden sich mehrere aktinische Keratosen in einem Hautareal, sprechen Medizinerinnen und Mediziner von einer „Feldkanzerisierung“. Häufig sind die rauen Stellen auf der Haut eher zu fühlen als zu sehen. Die meisten Betroffenen sind ansonsten beschwerdefrei, in eher seltenen Fällen kann die Haut auch jucken, brennen oder schmerzhaft stechen.
Medizinerinnen und Mediziner diagnostizieren die aktinische Keratose besonders häufig bei etwas älteren Menschen: 11,5 Prozent der 60- bis 70-Jährigen sind betroffen. Viele davon sind Männer oder Menschen mit einer helleren Haut.
Aktinische Keratose: Wer hat ein erhöhtes Risiko?
Eine Keratose ist eine Verhornung der Haut, der Zusatz „aktinisch“ bedeutet, dass sie „durch Strahlung“ verursacht ist. So tritt eine aktinische Keratose vermehrt bei Menschen auf, deren Haut im Laufe ihres Lebens besonders häufig und/oder lange der UV-Strahlung, also dem ultravioletten Licht der Sonne, ausgesetzt war. Die Haut „merkt“ sich die Strahlenbelastung über Jahre und sogar Jahrzehnte. Ein erhöhtes Risiko, eine aktinische Keratose zu entwickeln, haben insbesondere Menschen,
- die einen hellen Hauttyp, blondes oder rötliches Haar haben
- die sich beruflich viel im Freien aufhalten
- die in Regionen mit starker Sonneneinstrahlung leben
- die regelmäßig ins Solarium gehen
- die in der Vergangenheit bereits mehrere schwere Sonnenbrände hatten
- die genetisch bedingt besonders lichtempfindlich sind
- die ein geschwächtes Immunsystem haben, beispielsweise bei einer Krebstherapie, durch eine HIV-Infektion oder nach einer Organtransplantation
Insgesamt kommt es auf die Dosis der UV-Exposition an, also die Zeit insgesamt, in der die Haut der natürlichen oder künstlichen UV-Strahlung ohne ausreichenden Schutz ausgesetzt war. Deswegen können auch Menschen mit einem eher dunklen Hauttyp im Laufe der Zeit eine aktinische Keratose entwickeln.
Die AOK auf WhatsApp: einfach gesünder im Alltag
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal und erhalten Sie fundiertes Wissen, praktische Tipps und Inspirationen für eine gesunde Lebensweise – direkt auf Ihr Handy.
Wie ist der Verlauf bei einer aktinischen Keratose?
Aktinische Keratosen entstehen, wenn UV-Strahlung die hornbildenden Zellen in der obersten Hautschicht (Epidermis) schädigt, die sogenannten Keratinozyten. An den betroffenen Hautstellen bilden sich durch unkontrolliertes Wachstum dieser Hornzellen die schuppigen Veränderungen.
In manchen Fällen heilt eine aktinische Keratose selbstständig aus, typischerweise bleibt sie jedoch über mehrere Jahre bestehen. Im weiteren Verlauf können die Hautläsionen sich warzenartig verändern und über die umliegende Haut erhabene Flecken oder Knoten bilden, die im fortgeschrittenen Stadium auch bluten können. Unbehandelt kann eine aktinische Keratose dann in ein sogenanntes Plattenepithelkarzinom der Haut übergehen, weswegen die aktinische Keratose auch als Vorstufe des Plattenepithelkarzinoms gilt.
Das Plattenepithelkarzinom der Haut ist medizinisch auch unter den Begriffen spinozelluläres Karzinom oder Spinaliom sowie Stachelzellkrebs bekannt und nach dem Basalzellkarzinom die zweithäufigste Form des weißen oder hellen Hautkrebses.
Das Plattenepithelkarzinom der Haut ist ein bösartiger Tumor, der ohne Behandlung weiter wächst und das umgebende Gewebe zerstört. Ab einer bestimmten Größe des Tumors können sich auch Metastasen bilden, der Krebs streut also in andere Bereiche des Körpers.
Ein Plattenepithelkarzinom im frühen Stadium kann in der Regel gut behandelt werden. Hat der weiße Hautkrebs allerdings bereits Metastasen gebildet, ist die Aussicht auf Heilung schlechter. Rund fünf Prozent der Patienten und Patientinnen mit Tumoren über zwei Zentimeter Größe sind hiervon betroffen.
Deswegen ist es wichtig, schon die aktinische Keratose frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Passende Artikel zum Thema
Diagnose: Wie wird eine aktinische Keratose erkannt?
Wenn Sie neu aufgetretene raue Verfärbungen, schuppige Rötungen oder Erhebungen auf Ihrer Haut entdecken, die sich über die Zeit nicht zurückbilden, ist es ratsam, eine hausärztliche oder dermatologische Praxis aufzusuchen. Durch gründliches Untersuchen der Haut können Ärztinnen und Ärzte die aktinische Keratose meist mit bloßem Auge oder unter Vergrößerung mit einem sogenannten Dermatoskop erkennen. Ist die Diagnose unklar, kann durch eine Biopsie eine kleine Gewebeprobe zur mikroskopischen Untersuchung entnommen werden.
Wichtig ist es zudem, die aktinische Keratose durch eine klare Diagnose von anderen, harmloseren Hauterkrankungen abzugrenzen. Ein ähnliches Erscheinungsbild zeigt beispielsweise eine seborrhoische Keratose, im Volksmund als „Alterswarzen“ bekannt. Diese Hauterscheinung hat jedoch nichts mit Hautkrebs zu tun und muss auch nicht behandelt werden – allenfalls aus kosmetischen Gründen.
Anders verhält es sich bei der sogenannten Bowen-Krankheit, die sich ebenfalls durch rötliche, schuppende Hautveränderungen zeigt. Bei ungefähr drei Prozent der Menschen mit Morbus Bowen bildet sich ebenfalls ein Plattenepithelkarzinom.
Passende Angebote der AOK
Hautkrebsvorsorge: Das übernimmt die AOK
Gesetzlich Krankenversicherte haben grundsätzlich ab dem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre Anspruch auf einen kostenlosen Haut-Check. Die Angebote der AOK unterscheiden sich regional.AOK-Clarimedis: medizinische Informationen am Telefon
Medizinische Auskünfte erhalten AOK-Versicherte am kostenfreien AOK-Clarimedis-Info-Telefon.
Therapie: Wie lässt sich eine aktinische Keratose behandeln?
Eine aktinische Keratose sollte grundsätzlich behandelt werden, auch wenn sie sich in einigen Fällen von selbst wieder zurückbildet. Denn es ist nicht vorhersehbar, aus welchen der schuppigen Flecken sich ein Plattenepithelkarzinom und damit ein weißer Hautkrebs entwickelt.
Die Art und Weise der Behandlung richtet sich nach dem Alter und dem persönlichen Risiko, beispielsweise bei immungeschwächten Patientinnen und Patienten, sowie nach der Anzahl, der Lage und Größe der Flecken.
Zum einen gibt es die Möglichkeit, die aktinische Keratose mit verschiedenen Cremes zu behandeln. Diese Cremes enthalten Wirkstoffe wie Imiquimod, Diclofenac, 5-Fluorouracil oder Tirbanibulin und werden regelmäßig auf die betroffenen Stellen aufgetragen, wodurch sich die Hautveränderungen in der Regel zurückbilden.
Weitere Möglichkeiten, eine aktinische Keratose zu behandeln:
- Kältetherapie (Kryotherapie): Einzelne Hautstellen werden mit flüssigem Stickstoff benetzt, die aktinischen Keratosen bilden sich zurück.
- Operation: Die Hautveränderungen werden chirurgisch entfernt. Anschließend ist eine mikroskopische Untersuchung des entnommenen Gewebes möglich.
- Chemisches Peeling: Mehrere Keratosen oder eine größere Hautfläche werden behandelt, indem die oberen Hautschichten mittels Säure abgetragen werden.
- Lasertherapie: Die betroffenen Hautstellen können mit einem Laser bestrahlt und so entfernt werden.
- Photodynamische Therapie: Hierbei werden die aktinischen Keratosen mit einer speziellen lichtempfindlichen Creme vorbehandelt und anschließend mit Rotlicht oder Tageslicht bestrahlt.
Eine erfolgreiche Behandlung kann je nach Größe und Anzahl der Keratosen bis zu drei Monate dauern, verschiedene Therapiemöglichkeiten sind auch miteinander kombinierbar. Sprechen Sie vor der Behandlung mit Ihrer Dermatologin oder Ihrem Dermatologen über die Wirkung und eventuelle Nebenwirkungen der einzelnen Anwendungen.
Wichtig: Bei Menschen bestimmter Berufsgruppen, die sich besonders viel im Freien aufhalten und dabei lange den natürlichen UV-Strahlen ausgesetzt sind (sogenannte „outdoor worker“), wird die aktinische Keratose seit 2015 als Berufskrankheit anerkannt.

© iStock / Ridofranz
Prävention: Wie kann ich einer aktinischen Keratose vorbeugen?
Sie können viel tun, um sich vor einer aktinischen Keratose und damit vor einem möglichen weißen Hautkrebs zu schützen:
- Schützen Sie Kopf, Gesicht und den restlichen Körper vor Sonneneinstrahlung, indem Sie sich bevorzugt im Schatten aufhalten oder Kleidung mit langen Ärmeln und eine Kopfbedeckung tragen.
- Nutzen Sie eine Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor (mind. LSF 30).
- Vermeiden Sie Sonnenbrände.
- Meiden Sie die Sonne in der Mittagszeit.
- Gehen Sie nicht ins Solarium.
Eine aktinische Keratose kann auch nach erfolgreicher Behandlung wiederkehren. Daher ist es wichtig, Hautveränderungen im Blick zu behalten und im Zweifelsfall eine Ärztin oder einen Arzt aufzusuchen. Darüber hinaus haben alle gesetzlich Krankenversicherten ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre Anspruch auf eine Hautkrebsvorsorge. Die Kosten übernimmt die AOK.
Die Inhalte unseres Magazins werden von Fachexpertinnen und Fachexperten überprüft und sind auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.







