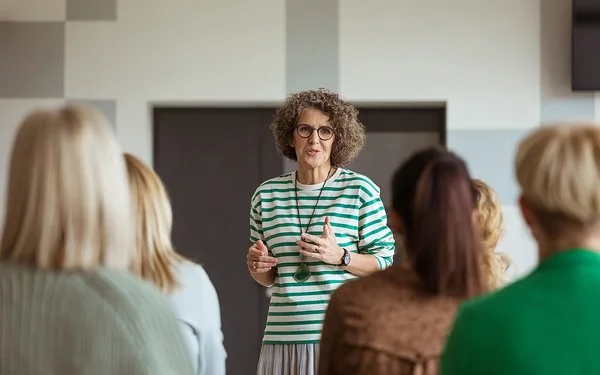Gehirn & Nerven
Anästhesie: Verschiedene Arten der Narkose im Überblick
Veröffentlicht am:10.08.2023
6 Minuten Lesedauer
Aktualisiert am: 01.08.2025
Ob Operation, Intensivmedizin oder ambulante Behandlung: Patienten und Patientinnen müssen dank guter Anästhesie bei einem medizinischen Eingriff keine Schmerzen leiden. Erfahren Sie mehr zu Voll- oder Teilbetäubung, PDA und Nervenblockade.<

© iStock / Wavebreak
Narkose: Welche Arten der Anästhesie gibt es?
Das Grundprinzip der Anästhesie oder Narkose lässt sich anhand der ursprünglichen Bedeutung beider Begriffe ableiten: Das Wort Narkose stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet übersetzt „Schläfrigkeit“, „Betäubung“ oder auch „Erstarrung“; der Begriff Anästhesie setzt sich aus den beiden altgriechischen Wörtern für „nicht“ und „Wahrnehmung“ zusammen. Doch nicht immer muss die Patientin oder der Patient tatsächlich in einen Tiefschlaf versetzt werden wie bei der sogenannten Vollnarkose, in der medizinischen Fachsprache Allgemeinanästhesie. Mit der Regionalanästhesie ist es möglich, einzelne Körperteile schmerzfrei zu schalten. Und mit der Lokalanästhesie oder örtlichen Betäubung lässt sich das Schmerzempfinden in kleinsten Bereichen des Körpers ausschalten. Sie kommt beispielsweise bei der Entfernung eines Blutschwamms auf der Haut oder bei einem zahnärztlichen Eingriff zum Einsatz.
Die verschiedenen Formen der Anästhesie können auch miteinander kombiniert werden. So können Medizinerinnen und Mediziner beispielsweise im Anschluss an eine Operation unter Vollnarkose zur Schmerzlinderung nach dem Eingriff eine Regionalanästhesie durchführen.
Allgemeinanästhesie: Was bedeutet Vollnarkose?
Der Begriff „Allgemeinanästhesie“ bezeichnet das, was die meisten Menschen umgangssprachlich als Vollnarkose kennen. Mithilfe von Medikamenten wird ein künstlicher, schmerzfreier und komatöser Zustand herbeigeführt. Ziel der Vollnarkose ist es, dass der Patient oder die Patientin während einer Operation nichts von dem Eingriff mitbekommt, ruhig liegt und keine Schmerzen empfindet. Um dies zu erreichen, wird bei der Allgemeinanästhesie eine Kombination von Medikamenten eingesetzt, die drei wesentliche Faktoren sicherstellt: Schmerzausschaltung, Bewusstseinsverlust und Muskelentspannung. Hierzu erhalten die zu behandelnden Personen in der Regel starke Schmerzmittel, hochwirksame Schlafmittel und sogenannte Relaxantien, die die Muskulatur entspannen. Dies erfolgt bei Erwachsenen intravenös über einen Venenzugang am Handrücken oder Arm. Bei kleinen Kindern ist es möglich, das Narkosemittel als Inhalationsgas über eine Gesichtsmaske einzuatmen und den Venenzugang erst zu legen, wenn der Tiefschlaf erreicht ist.
Da die eigenständige Atmung unter der Narkose stark eingeschränkt ist, müssen die Patientinnen und Patienten während der gesamten Operation beatmet werden. Dies geschieht über eine Gesichtsmaske, eine in den Rachen eingeführte Kehlkopfmaske oder einen Intubationsschlauch, der in die Luftröhre gelegt wird. Eine Allgemeinanästhesie oder umgangssprachlich Vollnarkose kommt bei größeren Operationen fast immer zum Einsatz, beispielsweise am Herzen, am Gehirn oder an der Lunge und im Bauchraum.
Passende Artikel zum Thema
Wie ist der Ablauf einer Allgemeinanästhesie?
Zur Vorbereitung auf die Operation sollten die Patientinnen und Patienten sechs Stunden vor dem Eingriff keine feste Nahrung oder trübe Flüssigkeit wie Fruchtsäfte mit Fruchtfleisch zu sich nehmen und spätestens zwei Stunden vor OP-Beginn auf klare Getränke wie Wasser verzichten. Außerdem ist es wichtig, Schmuck, Kontaktlinsen, Hörgeräte und Zahnprothesen vor dem Termin abzulegen. Informieren Sie die Anästhesistin oder den Anästhesisten während des Vorgesprächs über Erkrankungen oder Unwohlsein und sprechen Sie gegebenenfalls auch über Ihre Ängste.
Anästhesie-Vorgespräch Vor und während der Operation Wie lange schläft man nach einer Vollnarkose?
Welche Risiken gibt es bei einer Vollnarkose?
Dank hochqualifiziertem Personal, moderner Technik und Medikamenten sind schwere Nebenwirkungen bei Narkosen selten und auch das Risiko, an einer sogenannten Vollnarkose zu sterben, ist extrem gering. Die immer noch weit verbreitete Angst, nach einer Narkose „einfach nicht mehr aufzuwachen“, ist daher unbegründet.
Diese Komplikationen und Folgen können auftreten:
- Nebenwirkungen von Medikamenten
- Komplikationen im Herz-Kreislauf-System oder in der Lunge
- Verletzungen des Rachens, der Atemwege, der Stimmbänder, des oberen Verdauungstrakts oder im Bereich der Nase durch die Beatmung
- Aufwachen während der Narkose
- Übelkeit und Erbrechen nach dem Aufwachen
- Heiserkeit, Hustenreiz oder Halsschmerzen in den ersten 24 Stunden nach der Operation beispielsweise durch eine Kehlkopfmaske
- kurzzeitiges Kältegefühl oder Zittern durch Auskühlen während des Eingriffs
- Schäden an den Zähnen durch die Atemhilfe
In sehr seltenen Ausnahmefällen kann es bei einer Narkose zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen, wie etwa dem Einatmen von Erbrochenem (Aspiration) während der Operation oder Blut in der Lunge. Auch vorübergehende Denk-, Verhaltens- oder Bewusstseinsstörungen (postoperatives Delir) können nach der Narkose auftreten. Diese Risiken sind jedoch sehr selten.
Passende Angebote der AOK
Der Krankenhausnavigator der AOK
Mit der AOK-Krankenhaussuche finden Sie eine passende Klinik in Ihrer Nähe. Suchen Sie einfach mit Ihrer Diagnose nach einer geplanten Behandlung oder einem Fachgebiet.
Regionalanästhesie: Vorteile und Möglichkeiten der Teilnarkose
Wollen Medizinerinnen und Mediziner während des Eingriffs nur bestimmte Bereiche oder Körperteile schmerzfrei halten, nutzen sie die sogenannte Regionalanästhesie, auch Teilnarkose genannt. Dabei bleiben die Patientinnen und Patienten bei Bewusstsein, sind also während der medizinischen Behandlung ansprechbar. Erhalten sie zusätzlich ein leichtes Beruhigungs- oder Schlafmittel (Sedierung) können sie zwar schlafen, aber jederzeit geweckt werden.
Da bei der Regionalanästhesie nur ein Teil des Körpers betäubt wird, ist sie für die Patientinnen und Patienten schonender. Gleichzeitig gibt es andere Risiken für Komplikationen im Vergleich zur Allgemeinanästhesie, und durch die niedrigere Medikamentendosis treten Nebenwirkungen wie Übelkeit oder Erbrechen seltener auf.
Allerdings kann es auch bei einer Regionalanästhesie – je nach Methode – zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerz, Blutgerinnseln, Rückenschmerzen oder kurzzeitiger Übelkeit kommen. Katheter, die zur Regionalanästhesie genutzt werden, bergen immer auch ein Infektionsrisiko.
Die AOK auf WhatsApp: einfach gesünder im Alltag
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal und erhalten Sie fundiertes Wissen, praktische Tipps und Inspirationen für eine gesunde Lebensweise – direkt auf Ihr Handy.
Periduralanästhesie
Bei der Periduralanästhesie (PDA), auch Epiduralanästhesie, werden die Wurzeln der schmerzleitenden Rückenmarksnerven im sogenannten Periduralraum in der Nähe des Rückenmarks betäubt. Die Nerven können so kein Schmerzsignal mehr zum Gehirn weiterleiten.
Für die PDA führt der Anästhesist oder die Anästhesistin mithilfe einer Hohlnadel einen flexiblen Kunststoffschlauch zwischen zwei Wirbeln bis an die Rückenmarkshaut (Dura mater) ein. Über diesen Periduralkatheter wird das Medikament verabreicht, dessen Wirkung nach ungefähr 15 Minuten eintritt und mehrere Stunden anhält. Je nachdem, auf welcher Höhe der Wirbelsäule die PDA liegt, können Beine, Unterleib, Becken, Bauch oder Brustkorb während des Eingriffs schmerzfrei gehalten werden.
Anwendungsgebiete für eine PDA:
- Kaiserschnitt und gynäkologische Eingriffe
- Operationen an Harnblase, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse
- Operationen am Knie- oder Hüftgelenk
- Schmerzlinderung während der Geburt oder als Schmerzkatheter nach Operationen
Was ist eine Spinalanästhesie?
Die sogenannte Spinalanästhesie (SPA) ermöglicht schmerzfreie Eingriffe im Unterkörper, etwa am Becken oder an den Beinen. In Seitenlage kann auch gezielt ein einzelnes Bein betäubt werden.
Nach örtlicher Betäubung führt der Anästhesist oder die Anästhesistin eine feine Nadel in die Lendenwirbelsäule – allerdings tiefer als bei der PDA bis in den Rückenmarkskanal. So kann das Betäubungsmittel direkt in den mit Nervenflüssigkeit gefüllten Liquorraum, auch Hirnwasserraum genannt, injiziert werden. Die Wirkung tritt schneller ein als bei der PDA und hält etwa drei bis sechs Stunden an.
Was bedeutet Plexusanästhesie?
Für operative Eingriffe am Arm oder an der Schulter eignet sich die sogenannte Plexusanästhesie. Dabei wird das schmerzleitende Nervengeflecht, der Armplexus oder Plexus brachialis, betäubt. Der Armplexus verläuft von der Halswirbelsäule über die Achselhöhle bis zum Oberarm. Um beispielsweise Schmerzfreiheit für eine Operation an der Hand, am Unterarm oder am Ellenbogen zu erreichen, wird das Betäubungsmittel in die Achselhöhle verabreicht. Bei einem Eingriff am Oberarm oder der Schulter erfolgt die Injektion oberhalb des Schlüsselbeins.

© iStock / alvarez
Nervenblockade am Arm oder Bein
Das Nervengeflecht des Armplexus teilt sich am Oberarm in vier Nervenstränge. So können die von ihnen versorgten Bereiche des Arms, beispielsweise die Hand oder der Unterarm, auch einzeln schmerzfrei geschaltet werden. Fachleute sprechen dann von einer Nervenblockade am Unterarm.
Auch am Bein lassen sich die dort verlaufenden Nerven, der Femoris- und der Ischias-Nerv, gezielt betäuben. Dazu spritzen Mediziner und Medizinerinnen unterhalb der Leiste eine örtliche Betäubung. Durch die Nervenblockade am Bein lassen sich bestimmte Operationen am Kniegelenk und am Unterschenkel schmerzfrei durchführen. Soll nur der Fuß operiert werden, kann die Blockade auch vom Knie oder vom Fußgelenk aus erfolgen.
Intravenöse Regionalanästhesie
Die intravenöse Regionalanästhesie wird bei operativen Eingriffen an Unterarm und Hand oder Unterschenkel und Fuß eingesetzt, die nicht länger als eine Stunde dauern. Ärztinnen und Ärzte binden zunächst mit je einer Manschette oberhalb und unterhalb des betreffenden Körperteils die Blutzufuhr ab. Anschließend injizieren sie das Betäubungsmittel direkt in die Vene, wo es schnell seine Wirkung entfaltet.
Die Inhalte unseres Magazins werden von Fachexpertinnen und Fachexperten überprüft und sind auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.