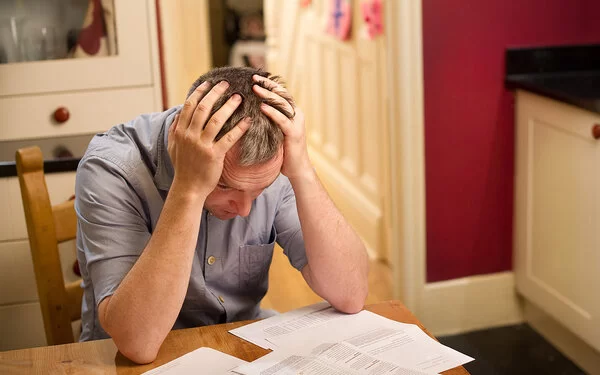Psychologie
Psychotherapie: Hilfe aus der Krise
Veröffentlicht am:31.03.2022
3 Minuten Lesedauer
Bei Angststörungen oder -Depressionen ist professionelle Hilfe wichtig – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Unterstützungsangebote und Therapien auf einen Blick.

© iStock / izusek
Hilfe finden bei psychischen Krankheiten
Es gibt verschiedene Gründe für psychische Erkrankungen. Manchmal werden sie durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst, wie beispielsweise einen Unfall, Jobverlust oder den Tod eines geliebten Menschen. Manchmal treten sie ohne offensichtlichen Grund auf. Häufig sind Depressionen und Angststörungen jedoch gut behandelbar. Je nach Schweregrad und individueller Situation können unterschiedliche Wege helfen, die Symptome deutlich zu reduzieren. Mögliche körperliche Ursachen psychischer Beschwerden – wie eine Schilddrüsenfehlfunktion – müssen vorher ausgeschlossen werden. Die bekanntesten Methoden sind eine ambulante Psychotherapie und wirksame Medikamente. Viele Betroffene mit einer leichten Erkrankung schaffen es aber bereits mit Hilfe einer Akutbehandlung beim Hausarzt, Facharzt oder Psychotherapeuten aus ihrer Krise.
Selbsthilfegruppen, Online-Angebote und Entspannungstechniken können ebenso unterstützen wie Bewegung und eine gute Tagesstruktur.
So hilft die AOK
Arztsuche im AOK-Gesundheitsnavigator
Finden Sie einen Psychotherapeuten in Ihrer Nähe.

© iStock / Tempura
Psychotherapie: verschiedene Methoden
Die häufigsten ambulanten Psychotherapien – die Kurzzeit- und die Langzeittherapie – sind als Einzeltherapie oder als Gruppentherapie verfügbar. Im Mittelpunkt steht das Gespräch zwischen Therapeuten und Betroffenen. Ein Überblick über die unterschiedlichen Verfahren:
- Verhaltenstherapie: Patienten arbeiten mithilfe des Therapeuten problematische Verhaltensweisen, Denkstrukturen und Einstellungen heraus – mit dem Ziel, diese zu verändern und Lösungen für aktuelle Probleme zu finden. Bei Angststörungen eignet sich eine Verhaltenstherapie am besten. Ihre Wirkung bei Depressionen ist ebenfalls sehr gut in Studien untersucht.
- Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: Während der Therapie stehen unbewusste Konflikte und Erfahrungen aus früheren Lebensabschnitten im Fokus, die aktuellen Problemen zugrunde liegen. Sie werden herausgearbeitet und bestenfalls gelöst.
- Analytische Psychotherapie: Im Mittelpunkt steht die Aufarbeitung vergangener Erfahrungen. Ziel ist es, sich frühere Beziehungsmuster, verdrängte Gefühle, Erinnerungen und innere Konflikte bewusst zu machen und zu lösen. Dieses Verfahren nimmt meist längere Zeit in Anspruch.
- Systemische Therapie (für Erwachsene): Soziale Beziehungen in der Familie können einer Erkrankung zugrunde liegen oder deren Symptome verstärken. Die Therapie bezieht Familienmitglieder mit ein, um gemeinsam Verhaltensweisen zu ändern und Beziehungen anders zu gestalten oder wahrzunehmen. So werden Lösungen für aktuelle Probleme entwickelt.
- Medikamentöse Therapie: Zusätzlich zur Psychotherapie kann eine ergänzende medikamentöse Therapie sinnvoll sein. Sowohl für Angststörungen als auch für Depressionen wirken Medikamente aus der Gruppe der Antidepressiva. Diese kann nur ein Arzt verordnen. Je nach Diagnose und den Symptomen kommen verschiedene Wirkstoffe zum Einsatz. Bei starken Beschwerden kann ein Aufenthalt in einem Krankenhaus oder einer Tagesklinik nötig sein.
Der Weg zur ambulanten Psychotherapie
Schritt 01/04
Diagnose
Wenn ein Hausarzt oder Facharzt eine psychische Erkrankung festgestellt hat, kann er zu einem psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten überweisen. Aber auch der direkte Weg (ohne Überweisung) zur psychotherapeutischen Versorgung ist möglich. Alle Psychotherapeuten mit kassenärztlicher Zulassung bieten Sprechstunden an, um eine erste Einschätzung zu den Beschwerden und der Diagnose sowie eine Empfehlung zur weiteren Behandlung zu geben. Eine Akutbehandlung kann nach Möglichkeit sofort starten.
Wichtig: Eltern miteinbeziehen
Eine Beratung über den Umgang mit Symptomen sowie die mögliche Beseitigung belastender Faktoren im Alltag ist ratsam. Meist ist es hilfreich, auch Lehrer und andere Bezugspersonen über die Erkrankung und Therapie zu informieren.
Angebote für Hilfe im Netz
- Familiencoach Depression: 4-stufiges Online-Selbsthilfeprogramm (anonym, kostenfrei) für Angehörige depressiver Patienten. Es umfasst:
- Depression und Alltag: grundlegende Tipps für den Umgang mit depressiven Angehörigen
- Selbstfürsorge: Wie helfe ich, ohne mich selbst dabei zu vergessen?
- Beziehungsmodul: den Alltag als Paar meistern trotz Depression
- Zusätzliches Beratungsangebot, auch durch Experten-Videochat
- Moodgym: Präventives Online-Selbsthilfeprogramm für Betroffene zur Vorbeugung und Verringerung depressiver Symptome zur Überbrückung von Wartezeiten und als zusätzliches Angebot zur Therapie (anonym, kostenfrei, kein Therapieersatz)
- Projekt „Die Mitte der Nacht“: Für Betroffene und Angehörige: Auf dieser Seite können sich Betroffene über ihre Erfahrungen im mit Depressionen austauschen und berichten, was ihnen geholfen hat.
- Jugend Notmail: vertrauliche und kostenfreie Online-Beratung für unter 19-Jährige.
- ADHS – Elterntrainer: Ein Online-Training für Eltern von verhaltensauffälligen oder hyperaktiven Kindern.