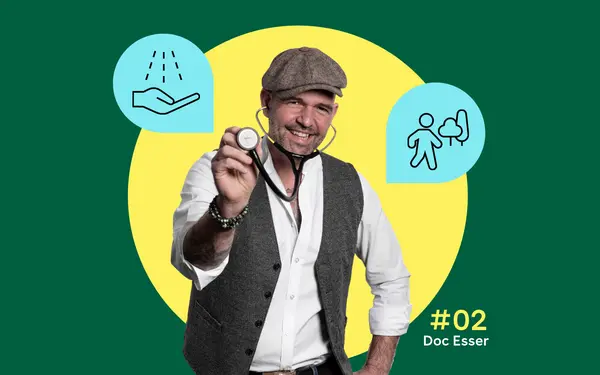Immunsystem
Pfeiffersches Drüsenfieber: weitverbreitet und meist harmlos
Veröffentlicht am:20.08.2025
4 Minuten Lesedauer
Das Pfeiffersche Drüsenfieber tritt vor allem im Herbst und Frühjahr auf. Wer erkrankt, kann die Beschwerden leicht mit denen einer Erkältung oder Grippe verwechseln. Wie eine Infektion verläuft und welche Spätfolgen möglich sind.

© iStock / Edwin Tan
Was versteht man unter dem Pfeifferschen Drüsenfieber?
Beim Pfeifferschen Drüsenfieber handelt es sich um eine weitverbreitete Viruserkrankung, die in der überwiegenden Anzahl der Fälle harmlos verläuft. Die Erkrankung hat viele Namen. Auf ihren Entdecker Emil Pfeiffer geht die Hauptbezeichnung zurück. Der Kinderarzt ließ die Kernsymptome mit in die Namensgebung einfließen: Die Drüsenschwellung und das Fieber. Mediziner und Medizinerinnen nennen die Erkrankung aber auch infektiöse Mononukleose. Erkrankte weisen im Blutbild eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen mit nur einem Zellkern auf (mono = „einzeln“, nukleo = „Kern“). Die für die Erkrankung verantwortlichen Viren werden mit dem Speichel übertragen. Zudem betrifft die Infektion insbesondere Teenager und junge Erwachsene. Deshalb ist das Pfeiffersche Drüsenfieber auch als „Kusskrankheit“ oder „Studentenfieber“ bekannt. Durch die Vielzahl romantischer Begegnungen, die oft in diesem Alter stattfinden, hat es das Virus besonders leicht, sich zu vermehren. Das Pfeiffersche Drüsenfieber verursacht bei kleineren Kindern häufig keine Krankheitssymptome und heilt innerhalb von zwei bis vier Wochen problemlos aus, im späteren Lebensalter kommt es zum typischen Krankheitsverlauf.
Passende Artikel zum Thema
Welches Virus löst das Pfeiffersche Drüsenfieber aus?
Für das Pfeiffersche Drüsenfieber ist das sogenannte Epstein-Barr-Virus (EBV) verantwortlich, das zur Familie der Herpesviren gehört. Schätzungsweise stecken sich mehr als 90 Prozent aller Menschen vor dem 30. Lebensjahr mit dem Virus an. Die Übertragung erfolgt über infizierten Speichel, etwa über geteiltes Geschirr im Kindergarten oder über das Küssen. Die Erkrankung verläuft im Kindergartenalter meist asymptomatisch, in späteren Jahren mit dem typischen Krankenheitsbild. Wer mit dem Epstein-Barr-Virus infiziert war, hat einen lebenslangen Schutz gegen eine erneute Ansteckung. Allerdings können die Viren nach ihrem Eindringen im Körper verbleiben und wieder aktiv werden, wenn die körpereigene Abwehr geschwächt ist. Reaktivierte Viren können dann unwissentlich an andere Menschen weitergegeben werden. Schließlich zeigt der Träger oder die Trägerin selbst keine Krankheitssymptome. Doch wann treten eigentlich die ersten Symptome beim Pfeifferschen Drüsenfieber auf? Falls die Infektion tatsächlich zur Erkrankung führt, vergehen rund vier bis sechs Wochen.
Was sind Symptome beim Pfeifferschen Drüsenfieber?
Erwachsene entwickeln häufiger Symptome nach einer Epstein-Barr-Virus-Infektion als Kindergartenkinder. Das Ziel der Viren sind die Schleimhautzellen im Nasen-Rachen-Bereich, wo sie sich vermehren, und dort spezifische Immunzellen, die B-Lymphozyten.
Diese Symptome können beim Pfeifferschen Drüsenfieber auftreten:
- Halsschmerzen, ausgelöst durch Entzündungen im Rachen und an den Mandeln
- Fieber
- beidseitige Schwellungen der Lymphknoten am Hals
- Abgeschlagenheit
- Übelkeit
- Kopfschmerzen
Bei der seltenen exanthematischen Form kommt es zusätzlich zu einem Hautausschlag. Meistens tritt die glanduläre Form mit generalisierter Lymphknotenschwellung, Mandelentzündung und Milzschwellung auf. Selten schwillt die Milz derart an, dass sie reißt.
Passende Angebote der AOK
AOK-Clarimedis: medizinische Informationen am Telefon
Rund um die Uhr an 365 Tagen: Das medizinische Infotelefon AOK-Clarimedis bietet Versicherten kostenlose Beratung durch medizinische Expertinnen und Experten zu Diagnosen, Laborwerten, Vorsorge und vielen weiteren Gesundheitsthemen.
Die möglichen Spätfolgen des Pfeifferschen Drüsenfiebers im Überblick
Innerhalb von drei Wochen haben viele Menschen die Infektionskrankheit komplikationslos überstanden. Es können aber Wochen bis Monate vergehen, bis die Betroffenen ihre volle Leistungsfähigkeit wiedererlangen. In seltenen Fällen kommt es zu Komplikationen: Betroffene erleiden eine Entzündung des Herzmuskels oder der Hirnhaut, aber auch eine chronische Müdigkeit über Monate mit Antriebslosigkeit oder allgemeine Schwäche ist möglich.

© iStock / cyano66
So wird das Pfeiffersche Drüsenfieber diagnostiziert und behandelt
Kommen Menschen mit den typischen Symptomen wie Fieber und Halsschmerzen in eine Praxis, grenzt der Arzt oder die Ärztin die Erkrankung zunächst von anderen ab, zum Beispiel von einer Mandelentzündung. Dies geschieht mithilfe des ärztlichen Gesprächs, der sogenannten Anamnese, und der körperlichen Untersuchung. Bei typischen Zeichen wie geschwollenen Lymphknoten wird außerdem Blut abgenommen. Zudem wird der Bauchraum per Ultraschall untersucht und die Milzgröße abgemessen. Im Blutbild können die weißen Blutkörperchen verändert und ihre Anzahl erhöht sein. Auch ein Erregernachweis mithilfe spezifischer Antikörper gegen das Virus im Blut ist möglich. Eine zielgerichtete Behandlung gegen die Infektion ist nicht möglich. Die Symptome können aber mithilfe entzündungshemmender Schmerzmittel gelindert werden. Klassischerweise kommt dann Ibuprofen zum Einsatz. Es lindert die Schmerzen und senkt das Fieber. Nur bei einer zusätzlichen bakteriellen Infektion, einer sogenannten Sekundärinfektion, ist die Gabe von Antibiotika nötig. Betroffene sollten sich grundsätzlich viel ausruhen, viel trinken und keinen Sport treiben.
Tipps für den Umgang mit Pfeifferschem Drüsenfieber
Das Epstein-Barr-Virus ist weit verbreitet. Menschen, die wissen, dass sie infiziert sind (auch ohne Symptome) sollten folgendes beachten, insbesondere im Umgang mit immungeschwächten Personen:
- Übertragungswege kontrollieren: Es gibt keine Impfung, mit der Menschen sich vor der Erkrankung schützen können. Grundsätzlich sollte man gewisse Hygieneregeln beachten: Hände waschen, Niesen in die Armbeuge, zur Begrüßung keine Küsschen, nicht das Besteck mit Infizierten teilen.
- Geduld mitbringen: Genügend Ruhe, eine ausreichende Trinkmenge, insbesondere bei Fieber, und leichte Kost sind im akuten Stadium wichtig. Neben fiebersenkenden Medikamenten können auch Hausmittel Linderung verschaffen. Wadenwickel werden bei Fieber oft als wohltuend empfunden, außerdem bieten sich Quarkwickel rund um den schmerzenden Hals an.
- Mit Sport warten: Auch wer sich körperlich wieder besser fühlt, sollte sicherheitshalber vier bis sechs Wochen mit sportlichen Aktivitäten warten, um Komplikationen wie eine Herzmuskelentzündung möglichst zu vermeiden. Personen, die Leistungssport betreiben, sprechen am besten mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin über den besten Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Sportprogramms.
Die Inhalte unseres Magazins werden von Fachexpertinnen und Fachexperten überprüft und sind auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.