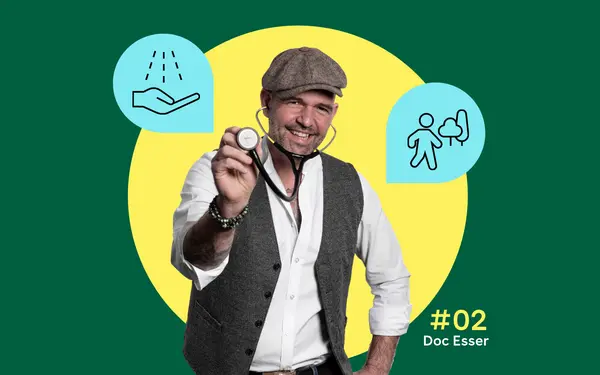Immunsystem
Tetanus: Nur die regelmäßige Impfung schützt vor dem Wundstarrkrampf
Veröffentlicht am:09.05.2022
5 Minuten Lesedauer
Aktualisiert am: 31.07.2025
Muskelkrämpfe und starke Schmerzen nach einer vermeintlich harmlosen Wunde: Früher endete die Infektion mit dem Tetanus-Erreger meist tödlich. Heute gehört die Impfung gegen Wundstarrkrampf zur Regelversorgung und hat nur selten Nebenwirkungen.

© iStockn / miljko
Tetanus: Was ist Wundstarrkrampf?
Der Wundstarrkrampf (Tetanus) ist eine weltweit verbreitete bakterielle Infektionskrankheit. Auslöser von Tetanus ist das Bakterium Clostridium tetani, dessen Sporen sich unter anderem in Staub, Schmutz, Erde sowie menschlichen und tierischen Fäkalien wiederfinden – also nahezu überall. Typisch für eine Infektion sind kleine Verletzungen durch Gegenstände wie Dornen oder rostige Nägel. Kommt eine Wunde mit dem Tetanus-Erreger in direkten Kontakt, kann eine Tetanusinfektion entstehen. Ob es sich um eine Bisswunde, einen Stich, Kratzer oder eine Verbrennung handelt, spielt für die Übertragung keine Rolle.
Haben sich aus den Sporen des Erregers im Körper Bakterien entwickelt, produzieren diese Nervengifte (Neurotoxine), die über Lymph- und Blutbahnen verteilt werden und die Symptome auslösen. Charakteristisch sind starke Krämpfe. Ist die Atem- und Schluckmuskulatur betroffen, droht Ersticken. Die Zeit vom Eintritt der Erreger in den Körper bis zum Ausbruch der Krankheit (Inkubationszeit) liegt in der Regel zwischen wenigen Tagen und drei Wochen. Ansteckend ist Tetanus nicht.
Früher verlief Tetanus fast immer tödlich. Heute führt die Infektion trotz moderner Intensivmedizin noch bei zehn bis zwanzig Prozent der Betroffenen zum Tod – meist durch Atemnot oder Herzversagen. Ohne intensivmedizinische Betreuung liegt die Todesrate sehr viel höher. Der beste Schutz gegen Tetanus ist die Impfung.
Auffrischungs-Impfung: Tetanus
Der Wundstarrkrampf ist eine weltweit verbreitete Erkrankung, die heute in vielen Ländern des globalen Südens und in Ländern mit niedriger Impfquote immer noch ein großes Problem darstellt. In Deutschland dagegen werden laut Robert Koch-Institut (RKI) weniger als 15 Fälle pro Jahr bekannt, was auf den guten Impfschutz zurückzuführen ist. Damit dieser gleichbleibend hoch ist, sollten Sie spätestens nach zehn Jahren die Tetanus-Impfung auffrischen lassen.
Symptome und Verlauf von Tetanus
Eine Tetanus-Diagnose erfolgt in der Regel durch sicht- und spürbare Beschwerden. Erste Symptome sind Schlafstörungen, Schwitzen und Unruhe. Später spannen sich die Muskeln an, es treten Krämpfe auf, beginnend bei der Kiefermuskulatur. Die Mimik wirkt wie eingefroren. Die Betroffenen können nur schwer sprechen und schlucken, was das Trinken und die Nahrungsaufnahme erschwert.
Im weiteren Verlauf der Tetanus-Infektion setzt die gewohnte Muskelfunktion in anderen Körperbereichen sukzessive aus. Es kommt zu Muskelanspannungen, Muskelstarre (Rigor) und Krämpfen im Nacken, Rücken, Bauch sowie an Beinen und Armen. Die Krämpfe können so extrem sein, dass die Knochen brechen. Für Betroffene bedeutet das schmerzhafte Qualen bei klarem Bewusstsein, wobei sich die Symptome durch Sinnesreize verstärken, etwa durch Licht, Geräusche und Berührungen.
Der höchste Schweregrad ist erreicht, wenn die Atemmuskulatur, Kehlkopf und Brustmuskel von den Krämpfen betroffen sind. Dann können Erkrankte ersticken oder einen Herztod erleiden.
Neben der allgemeinen (generalisierten) Form von Tetanus, die alle Nervenbahnen, Muskeln und Organe betrifft und überwiegend bei Ungeimpften auftritt, existiert eine Variante, die nur im Wundbereich auftritt. Diese zeigt sich meistens bei teilimmunisierten Menschen, deren Impfschutz für eine vollständige Abwehr der Erreger nicht ausreicht. Diese Form ist nicht ganz so gefährlich, kann sich jedoch auf den restlichen Körper ausweiten.
Wie wird Tetanus behandelt?
Ist ein Wundstarrkrampf bereits eingetreten, werden vielfältige Therapieformen kombiniert. Die Wunde wird gut gesäubert, ausgeschnitten und offen behandelt, da eine Zufuhr von viel Sauerstoff dem Bakterium schadet.
Die Ärzte injizieren einen Tetanus-Immunglobulin (Antikörper), um das im Blut zirkulierende Gift zu neutralisieren. Die Gabe eines Tetanus-Toxoids wird als aktive Immunisierung eingesetzt. Ein Toxoid ist ein inaktiviertes, nicht mehr schädliches Gift (Toxin). Darüber hinaus soll die Einnahme von Antibiotika die Vermehrung und das Überleben des Erregers erschweren. Eine umfassende intensivmedizinische Behandlung ist erforderlich. Sie dient der Erhaltung der lebenswichtigen Funktionen und soll Komplikationen vermeiden. Oftmals ist eine künstliche Beatmung lebensrettend.
Tetanus vorbeugen: Wie gut schützt eine Impfung?
Verletzungen lassen sich im Alltag nie vollständig vermeiden. Es ist praktisch unmöglich, niemals mit dem Tetanus-Erreger in Kontakt zu kommen. Eine Impfung ist die einzige Möglichkeit, einem Wundstarrkrampf zuverlässig vorzubeugen. Selbst nach einer überstandenen Infektion kann die Krankheit erneut ausbrechen. Bei nicht oder nicht ausreichend Geimpften wird im Falle einer risikoreichen Verletzung eine Tetanus-Immunprophylaxe empfohlen – so schnell wie möglich. Fehlende Impfungen der Grundimmunisierung sind den Empfehlungen entsprechend nachzuholen. Verletzt sich eine Person mit vollständigem Impfschutz gegen Tetanus, ist meist keine Behandlung notwendig. Um den Impfschutz aufrechtzuerhalten, ist eine regelmäßige Auffrischung wichtig.
Informieren Sie sich jetzt
10 Gründe fürs Impfen
Es gibt viele gute Gründe, um sich impfen zu lassen.Impfstoff und Impfungen
Die AOK berät Sie zum Thema Impfungen und bietet Unterstützung bei der persönlichen Impfentscheidung an.

© iStock / elenaleonova
Die Tetanus-Impfung bei Kindern
Kinder erhalten die Schutzimpfung in Deutschland üblicherweise bereits im Säuglingsalter über die Grundimmunisierung in drei Dosen. Sie bekommen einen Kombinationswirkstoff, der nicht nur vor Tetanus, sondern auch vor Keuchhusten (Pertussis), Diphtherie, Hepatitis B, dem Erreger Haemophilus influenzae Typ b (Hib) und Kinderlähmung schützt. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) sieht die Impfung im Alter von zwei, vier und elf Monaten vor. Bei Frühgeburten soll eine weitere Impfung im dritten Lebensmonat für zusätzlichen Schutz sorgen. Kurz vor der Einschulung im 6. Lebensjahr erhalten Kinder dann in der Regel ihre erste Auffrischungsimpfung, gefolgt von einer weiteren zwischen dem 10. und 17. Lebensjahr.
Passende Angebote der AOK
Impfschutz für Babys, Kinder und Jugendliche
Kinder impfen zu lassen, leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit der Kleinen. Erfahren Sie hier, welche Impfungen für Kinder sinnvoll sind.
Die Tetanus-Impfung bei Erwachsenen: Wie oft soll man sich impfen lassen?
Bei Erwachsenen wird danach unterschieden, ob man als Kind bereits gegen Tetanus geimpft wurde oder nicht:
- Fehlende Impfungen nachholen: Wer als Kind keine Tetanus-Impfung erhalten hat (Grundimmunisierung) oder wer nur einen unvollständigen Impfschutz hat, sollte die noch fehlenden Impfungen möglichst schnell nachholen lassen. Ein Blick in den Impfpass gibt Aufschluss.
- Tetanus-Auffrischung: Wer als Kind die Grundimmunisierung zum Schutz vor Tetanus erhalten hat, sollte den Impfschutz alle zehn Jahre erneuern, so die Empfehlung der STIKO. Bei einer akuten Verletzung kann es sinnvoll sein, den Impfschutz zu einem früheren Zeitpunkt aufzufrischen.
Welche Nebenwirkungen kann eine Tetanus-Impfung haben?
In der Regel vertragen Kinder und Erwachsene die Tetanus-Impfung gut. Nach dem Einstich können als lokale Reaktion rund um die Einstichstelle Rötungen und Schwellungen auftreten. Diese klingen meist nach wenigen Tagen wieder ab. Seltener treten innerhalb der ersten drei Tage als Nebenwirkung auf die Tetanus-Impfung allgemeine Krankheitszeichen auf. Dazu zählen Frieren, Abgeschlagenheit, Temperaturerhöhung, Muskelschmerzen oder Magen-Darm-Probleme. Diese Impfreaktionen verschwinden in der Regel nach ein bis drei Tagen. Zudem ist es möglich, dass der Körper auf einen Bestandteil des Impfstoffs allergisch reagiert. Schwere Nebenwirkungen sind dagegen sehr selten. Wer sich wegen möglicher Reaktionen unsicher ist oder weitere Informationen benötigt, wendet sich am besten an den behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin.
Die Inhalte unseres Magazins werden von Fachexpertinnen und Fachexperten überprüft und sind auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.